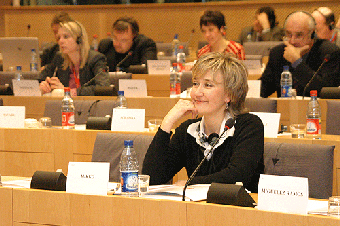So beschreibt der neue Außenminister sein erstes Brüsseler EU-Treffen. Eine tapfere Haltung
Guido Westerwelle steigt am Brüsseler Ratsgebäude aus der schwarzen Staatslimousine, stellt sich vor die Kameras und sagt, es sei „eine glückliche Fügung“, dass er gleich an seinem ersten Tag als Außenminister so viele seiner europäischen Kollegen treffen könne. Wenn bloß sein Gesichtsausdruck zu diesem Glück passen würde. Westerwelles Physiognomie besiegt seine Psychologie an diesem ersten Amtstag. Alles andere wäre allerdings auch merkwürdig.
Als gerade erst ernannter Außenminister ein EU-Gipfeltreffen absolvieren zu müssen, dürfte in Wahrheit ungefähr eine so glückliche Fügung für Westerwelle sein wie für einen Nichtschwimmer der Sturz in ein Wettkampfbecken.
Natürlich hat ihn sein Stab noch gebrieft auf dem Weg nach Brüssel, über die Kollegen, die er treffen wird, und über die Themen, die auf ihn warten. Aber Europa, dieses Gehege aus 27 Regierungen, Temperamenten, Positionen und Politiken, erschließt sich nicht aus Unterlagen. Das weiß Westerwelle. Und er weiß auch, dass die Brüsseler Journalisten das wissen. Deswegen versucht er gar nicht erst, Ahnung zu markieren. Statt dessen gibt er den demütigen Newcomer.
Er lässt die Kanzlerin reden vor der Presse. Er nickt beflissen, wenn sie über Institutionelles redet, über Klimaschutz oder über Europas künftige politische Spitzenposten. Er fügt Plattitüden hinzu. Es sagt in ihnen nichts Falsches, aber auch nichts Eigenes. Er stellt zum Beispiel – etwas zu länglich – fest, dass es bei der Afghanistan-Politik nicht mehr nur um Afghanistan geht, sondern auch um Pakistan, „denn es ist natürlich zusammenhängend, was wir da zu besprechen haben.“
Er sitzt vor einer blauen Europa-Wand, mit einem zusammengerissenem Gesicht, das nichts von seinem inneren Spagat verraten soll. Er ist einer, der horchen muss. Und gleichzeitig schon antworten soll. Auf der Abschlusspressekonferenz stellen drei ausländische Kollegen Fragen auf Englisch, sie möchten etwas über die Beitrittsverhandlung mit Albanien wissen. Westerwelle greift zaghaft nach dem Kopfhörer mit der Dolmetscherstimme. Dann scheint er zu merken, dass er die Frage auch so versteht, legt den Ohrclip wieder zurück. Man spürt, dass er zwischen zwei Entscheidungen schwankt: Der Wichtigkeit, jedes Wort zu verstehen. Und Fotos von einem Guido mit Knopf im Ohr. Von einem Außenminister, würden diese Bilder sagen, der mit dem Englischen kämpft. Die Kanzlerin rettet ihn. Sie sagt, Albanien habe nicht auf der Tagesordnung gestanden.
„Mit großer Freundlichkeit und großen Interesse“, betont Westerwelle mehrfach, sei er von Kollegen empfangen worden. Wenn es bloß freudiger klingen würde. Aber es klingt wie eine auswendig gelernte Floskel, wie ein Versatzstück aus dem Außenminister-Vokabular, das er sich für die ersten Tage zurecht gelegt hat.
Wie er sich nach dem zweiten Tag im Amt fühle, möchte ein Kollege zum Schluss wissen. „Man ist erschöpft“, sagt Westerwelle, „aber man ist auch zufrieden mit den Ergebnissen.“ Der erste Teil klingt ehrlich. Der zweite wieder wie aus dem Vokabelheft für junge Außenminister. Noch, sicher, ist nicht die Zeit für viel Eigenes. Noch ist Zeit für möglichst wenig Falsches. Doch schon beim nächsten EU-Gipfel wird der Anfänger-Bonus nicht mehr gelten.
Dann werden sich die Journalisten nicht mehr für sein Englisch, seine Krawatten und seinen Gesichtsausdruck interessieren. Sondern tatsächlich für seine Meinung.