Am vergangenen Montag und Dienstag gab es einen Dämpfer für alle Konjunkturoptimisten. Sowohl bei der Industrieproduktion als auch beim Auftragseingang gab es im Oktober im Vormonatsvergleich einen Rückgang – beim Auftragseingang den ersten seit acht Monaten. Wie lassen sich die Rückschläge interpretieren? Sie könnten ein Zeichen dafür sein, dass der Aufschwung noch keineswegs genug Eigendynamik entwickelt hat und er daher weiterhin die Hilfe der Wirtschaftspolitik braucht, also niedrige Zinsen, unbegrenzte Liquidität und massive staatliche Stimuli. Insgesamt ist die Datenlage ja noch positiv, aber ein Warnschuss waren die Zahlen schon. Noch ist es nicht ausgeschlossen, dass wir es mit einem Szenarium zu tun haben wie in Japan seit Anfang der 90er Jahre. Dass heißt, dass die Krise im Finanzsektor noch lange nicht überwunden ist und die Realwirtschaft nachhaltig belastet. Darauf verweist auch die Bundesbank in ihrem neusten Finanzstabilitätsbericht.
Dass es bisher konjunkturell gut lief, kann einen einfachen, gewissermaßen mechanischen Grund haben: In einer Erholungsphase, die auf eine tiefe Rezession folgt, sind die Zuwachsraten beim Output fast immer sehr hoch. Jemand hat vor Kurzem mal angemerkt, dass eine Gitarrensaite umso stärker zurückschnellt, je stärker vorher an ihr gezogen wurde. Bei der Konjunktur sei das auch so: Wenn die Rezession besonders tief war, der Abschwung dann aber erst einmal gestoppt ist – weil unter anderem der Lagerbestand ein noch tieferes Niveau als die Nachfrage erreicht hat -, geht es eine Weile mit Riesenschritten aufwärts. Ein anderer Grund für den bislang so robusten Expansionsprozess sind die Stützungsmaßnahmen der EZB und der Fiskalpolitik. Daraus kann, muss aber nicht, ein dauerhafter Aufschwung entstehen. Wie steht es damit?
Zunächst ein Blick auf die Zahlen: Der Auftragseingang in der Industrie hatte von Februar, dem bisherigen Tiefpunkt der Rezession, bis zum September real mit einer Verlaufsrate von 35,6 Prozent zugenommen, ist dann aber von September auf Oktober um 2,1 Prozent gesunken – er liegt damit immer noch um 26,5 Prozent unter dem zyklischen Höhepunkt vom vierten Quartal 2007. Real!
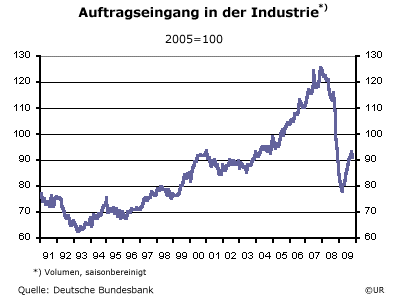
Bei der Produktion waren die Ausschläge nicht ganz so groß: (annualisierte) Verlaufsrate September gegen Februar +12,6 Prozent, dann im Oktober gegenüber September ein Rückgang um 1,8 Prozent; der Abstand zum ersten Quartal 2008, das bei dieser Datenreihe die zyklische Spitze markiert, vergrößerte sich dadurch auf 16,9 Prozent. Wenn man berücksichtigt, dass die deutsche Industrieproduktion im Trend jedes Jahr um 1,3 Prozent steigt, ergibt sich aktuell eine Outputlücke von fast 20 Prozent . Wir sind (waren) im Aufschwung, es fühlt sich aber nach wie vor sehr wie eine Rezession an.
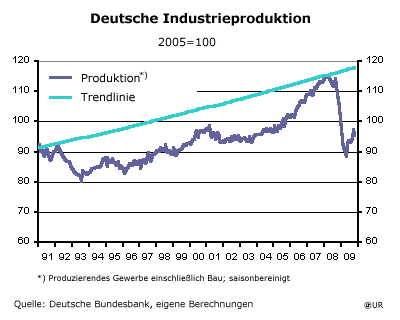
Die BIP-Zahlen für das dritte Quartal – von +0,7 Prozent im Vorquartalsvergleich – waren eigentlich eine Enttäuschung angesichts einer Zuwachsrate der Industrieproduktion von +3,6 Prozent (gegenüber dem zweiten Quartal). Wie bei der Industrieproduktion ist die Outputlücke so groß wie seit Menschengedenken nicht mehr: Die Differenz zwischen dem, was produziert wird und dem, was produziert werden könnte, beträgt rund 7,5 Prozent. Es wird noch viel Wasser den Rhein hinunterfließen, bis diese Lücke geschlossen ist.
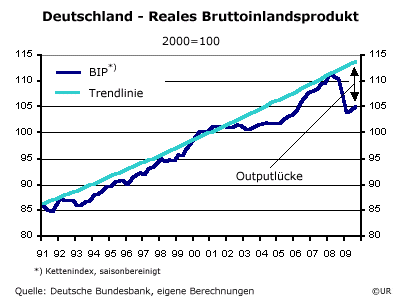
Wenn es jemals gelingen wird! Ich habe immer die japanischen Zahlen im Kopf, weil ich fürchte, dass es bei uns und in den anderen Industrieländern ähnlich ausgehen könnte wie in Japan: In den zehn Jahren bis zum Platzen der Aktienblase Anfang 1990 – die Immobilienblase platzte zwei Jahre später – hatte das reale BIP mit einer durchschnittlichen Rate von 4,7 Prozent zugenommen, seither sind es dagegen nur 0,9 Prozent. Carmen Reinhart und Kenneth Rogoff haben sich in ihrem kürzlich erschienen Buch („This time is different„) ausführlich mit den gemeinsamen Charakteristiken von Wirtschaftskrisen befasst. Ihre zentrale Botschaft lautet, dass Finanzkrisen, die auf das Platzen von Vermögenspreis-Blasen folgen, besonders hartnäckig sind und gewaltige Wohlstandsverluste bewirken. In Japan kam es zudem nicht nur zu einem dauerhaft niedrigen Wachstum, sonder auch zu einer anhaltenden Deflation: Im dritten Quartal dieses Jahres war das nominale Sozialprodukt nicht höher als Ende 1991, also vor genau 18 Jahren.
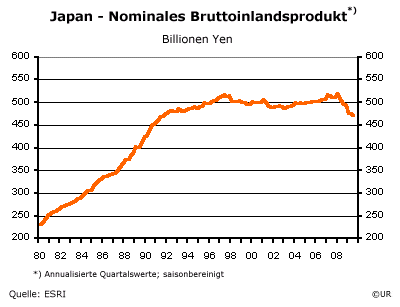
In Deutschland hatten wir es nicht mit dem Platzen von Blasen zu tun, sondern zum Einen mit einem Einbruch der Exporte und zum Anderen mit einer plötzlichen und in ihrem Ausmaß völlig unerwarteten Bankenkrise. Bei den Exporten waren natürlich die Bankenkrisen in den USA, in Großbritannien, Irland und Osteuropa mit im Spiel, diese wiederum ausgelöst durch den Einbruch der dortigen Immobilienpreise und – im Falle unserer östlichen Nachbarn – der Wechselkurse. Dass die deutschen Banken so ins Schleudern kamen, obwohl es im Inland kaum überschuldete Haushalte und Unternehmen gab, hatte vor allem damit zu tun, dass sie mangels tragfähiger Geschäftsmodelle (vor allem amerikanische und osteuropäische) Aktiva erwarben, über deren Risiken sie nicht viel wussten, die aber eine attraktive Rendite versprachen. Mit viel geliehenem Geld, also ganz langen „Hebeln“, blähten sie ihre eigenen Bilanzen und die ihrer ausgelagerten Spezialvehikel auf. Als dann die Marktwerte dieser Aktiva einbrachen und sich die Gewinne durch die fälligen Abschreibungen in Verluste verwandelten, war ihre Kapitalbasis im Handumdrehen aufgezehrt. Zahlreiche Landesbanken, die IKB, die Commerzbank sowie die Hypo Real Estate standen kurz vor dem Aus. Sie überlebten nur durch Fusionen, großzügige Bewertungsregeln und Hilfen der Steuerzahler. Gesund sie noch lange nicht. Deutschland steckt nach wie vor in einer Finanzkrise.
Wenn ich sehe, dass die Kredite an deutsche Unternehmen und Privatpersonen seit Dezember 2008 mehr oder weniger stagnieren und seit Juli sogar rückläufig sind, wird mir ganz anders. Es spricht einiges dafür, dass wir auf eine ausgewachsene Kreditklemme zusteuern, also eine Situation, in der es für die Banken vor allem darauf ankommt, ihre Bilanzen zu sanieren. Sie versuchen, sich von so vielen Aktiva wie nur möglich zu trennen und nur die allerprofitabelsten und sichersten zu behalten. Die andere, komplementäre Strategie besteht darin, die Gewinne so gut es geht zu steigern und neues Kapital aufzunehmen. Die EZB und der deutsche Staat helfen ihnen dabei.
Japan lässt grüßen. Ein Hauptproblem Japans war und ist, dass der Bankensektor nicht nachhaltig saniert wurde. Da die Zinsen so niedrig waren, die Refinanzierungskosten der Banken also kaum verschieden von Null, bestand und besteht der Anreiz, eigentlich notleidende Kredite zu verlängern und überfällige Insolvenzen zu verschleppen. Die Ertragslage der Banken war andererseits so schlecht, dass sie kaum bereit waren, neue Risiken einzugehen. Auch ihre überschuldeten Kunden hatten mehrheitlich nur ein Ziel: ihre Bilanzen zu sanieren und so wenig wie möglich auszugeben. Seit Beginn der neunziger Jahre vermindert sich das Kreditvolumen. In Kürze kann hier das zwanzigjährige Jubiläum gefeiert werden.
Vor einigen Tagen hat die Bundesbank ihren Finanzstabilitätsbericht 2009 vorgelegt, dessen Lektüre ich nur wärmstens empfehlen kann. Nach wie vor gibt es erhebliche Risiken, und der Anpassungsprozess ist noch nicht abgeschlossen. Das zeigt sich, wie die Bundesbank meint, an den Friktionen in zahlreichen Marktsegmenten. An den Geldmärkten beispielsweise haben sich die Verhältnisse noch nicht normalisiert, nur „ein Teil der im Zusammenhang mit der Finanz- und Wirtschaftskrise zu erwartenden Wertberichtigungen [ist bisher] bewältigt“, und an „den Verbriefungsmärkten haben sich bislang noch kein neuen tragfähigen Strukturen herausgebildet.“ Die Lage könne sich sogar wieder verschlimmern, wenn die „in Gang gekommene Sanierung des Finanzsektors … durch umfangreiche Kreditausfälle in der gewerblichen Wirtschaft sowie im Bereich der Wohn- und Gewerbeimmobilien ins Stocken geraten“ sollte, wenn es nämlich zu einer langwierigen Stagnationsphase in den wichtigsten Volkswirtschaften kommen sollte.
Mir scheint, die Bundesbank ist eher skeptisch, was den Aufschwung angeht. Ein „Ausstieg aus den Stabilisierungsmaßnahmen [ist] nur in dem Maße zweckgerecht, in dem sich das Marktumfeld und die Widerstandskraft des Finanzsektors nachhaltig verbessert haben.“ Also bitte keine Eile bei den Exit-Strategien, die Krise ist noch nicht überwunden. Die Abwärtsspirale konnte zwar gestoppt werden, aber es gibt noch eine Fülle von (systembedrohenden) Risiken.
Die EZB vertritt erstaunlicherweise eine viel weniger klare Linie. Präsident Trichet musste sich in der Pressekonferenz vom 3. Dezember ziemlich winden: Zum Einen hatte er zu erklären, warum das nächste – und letzte – Einjahresgeschäft statt zu einem Prozent fest de facto zu einem variablen und damit möglicherweise steigenden Zinssatz ausgeschrieben wird, zum anderen, dass das bitte nicht als ein Signal für steigende Zinsen gewertet werden solle. Dahinter steckte wohl auch die Angst vor einem noch festeren Euro. Das war kein sehr glaubwürdiger Auftritt: Wurde nun ein „exit“ aus der Niedrigzinspolitik verkündet oder nicht?
So oder so, die Analysten in den Notenbanken des Eurosystems sind in ihrer Konjunktureinschätzung deutlich weniger optimistisch als die Marktteilnehmer. Das ist sehr ungewöhnlich. Normalerweise lauert für einen guten Bundesbanker hinter jeder Ecke ein Inflationsrisiko. Das ist im aktuellen Finanzstabilitätsbericht gar kein Thema – ein wichtiges, vielleicht das wichtigste Risiko besteht darin, dass es zu einer wirtschaftlichen Stagnation kommt, zu japanischen Verhältnissen eben.