Wahrlich, man muss schon von einem großen Wunder sprechen, wenn man sich die Entwicklung der deutschen Beschäftigung in der größten Wirtschaftskrise seit der Großen Depression der 1930er Jahre anschaut. Die meisten anderen OECD-Länder hatten einen geringeren Rückgang der realen Wirtschaftsleistung zu verzeichnen als Deutschland – aber sehr viel höhere Beschäftigungsverluste. Tatsächlich ist die Zahl der Beschäftigten in Deutschland seit dem Ausbruch der Krise relativ stabil geblieben. Wie kommt dieses Wunder zustande?
Waren es die Hartz-Reformen, die den Arbeitsmarkt flexibilisiert haben? Oder die Lohnzurückhaltung der letzten 15 Jahre? Oder war es die Kurzarbeit? Einiges davon – nicht alles – hat sicher geholfen. Zentral war aber die Verkürzung der Arbeitszeit insgesamt. Sie hat den meisten Beschäftigten den Job gerettet.
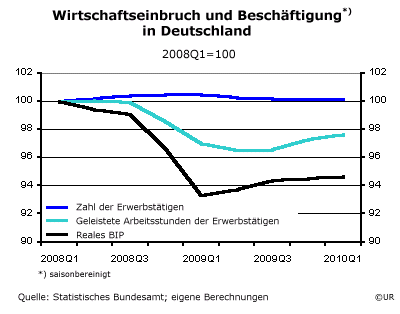
Die Hartz-Reformen haben ganz sicher kaum etwas mit dem Erfolg auf dem deutschen Arbeitsmarkt zu tun. Denn bei den Reformen ging es vor allem darum, die sowieso schon Arbeitslosen besser zu vermitteln und sie mit „Anreizen“, nämlich Kürzungen ihrer Ansprüche an den Sozialstaat, zur Aufnahme eines Jobs zu animieren. Bloß können solche Reformen kaum erklären, dass viele Unternehmen ihre Leute erst gar nicht entlassen haben. Die reformierte Arbeitslosenverwaltung und -versicherung kann nicht einspringen, wenn sie nicht in Anspruch genommen wird. Unmittelbar haben die Reformen also sicher nicht zum Wunder geführt.
Vielleicht aber mittelbar. Ein explizites Ziel der Reformen war, die Löhne insgesamt zu drücken, besonders im unteren Bereich. Die Lohnstagnation der letzten Jahre hat ja dazu geführt, dass die Gewinne der Unternehmen im Aufschwung geradezu explodiert sind. So konnten sie Rücklagen bilden, auf die sie in der Krise zurückgreifen konnten, ohne ihre Kosten durch Massenentlassungen reduzieren zu müssen. Sonst hätte es sicher noch mehr prominente Pleitekandidaten als Karstadt und Opel gegeben. Mit den Ersparnissen konnten sie zum Teil die in der Krise stark gestiegenen Lohnstückkosten finanzieren.
Aber die Lohnzurückhaltung im Aufschwung ist sicher nicht ausreichend dafür, den Arbeitsmarkterfolg in der Krise zu erklären. Denn irgendwie müssen die Unternehmen ja gerochen haben, dass der größte Einbruch des Wachstums seit dem Zweiten Weltkrieg nur von kurzer Dauer ist. Trotz Weltfinanz- und Wirtschaftskrise scheinen die Unternehmer nicht geglaubt zu haben, dass die Welt in eine neue Große Depression geraten könnte, das Welt-Finanzsystem kollabieren oder die Eurozone auseinander brechen würde – obwohl diese Horror-Szenarien nicht völlig unrealistisch waren. Hätten die deutschen Unternehmen allen Kassandra-Rufen geglaubt, hätten sie auch trotz Lohnzurückhaltung ihre Leute entlassen. Wer nicht an den nächsten Aufschwung glaubt, entlässt. So einfach ist das.
Joachim Möller, der Direktor des Nürnberger IAB argumentiert, die Unternehmen hätten unbedingt ihre gut ausgebildeten Arbeitnehmer halten wollen. Aber auch das Argument greift natürlich nur, wenn die Unternehmen das zum einen finanzieren können und zum anderen an den schnellen Aufschwung glauben.
Dazu kommt, dass eine ständige Lohnzurückhaltung, bei der die Arbeitnehmer noch nicht mal vom Aufschwung profitieren, eine sehr teure Versicherung gegen Arbeitslosigkeit ist. Zum einen verstärkt sich die Ungleichheit zwischen Arbeitseinkommensbeziehern und Kapitaleinkommensbeziehern; zum anderen hat die Lohnzurückhaltung zu einer Stagnation des Konsums und gleichzeitig zu einer massiven Verbilligung deutscher Exporte geführt. Das Resultat sind riesige Exportüberschüsse und entsprechende Defizite in Griechenland, Spanien und Co. – und damit zum Teil auch die momentane Eurokrise. Kurz, die Lohnzurückhaltung hat große Kollateralschäden hinterlassen.
Wirklich zentral für den Erhalt von Arbeitsplätzen war die Verkürzung der Arbeitszeit. Sie hat es erlaubt, die Beschäftigten zu halten. Das zeigen Studien von Joachim Möller vom IAB und von Alexander Herzog-Stein und Hartmut Seifert vom WSI der Hans-Böckler-Stiftung. Die Flexibilität, im Aufschwung mehr und im Abschwung weniger zu arbeiten, wurde in vielen Betrieben schon vor der Krise vereinbart – insbesondere in den Wirtschaftszweigen, die vor allem für den Export produzieren, etwa in der Metallindustrie. Und gerade den Export hat die Krise am heftigsten getroffen. Hinzu kommt die von der Regierung subventionierte Kurzarbeit, die einen wichtigen aber eben nicht den alleinigen Beitrag zur Arbeitszeitverkürzung geleistet hat. Viele Unternehmen haben auch ohne Kurzarbeit ihre Mitarbeiter weniger arbeiten lassen. Eine Umfrage unter Betriebsräten, die das WSI durchgeführt hat, hat ergeben, dass dreißig Prozent der Unternehmen auf flexible Arbeitszeitregelungen gesetzt haben – die Kurzarbeit haben zwanzig Prozent genutzt.
Das hat zu einem erstaunlichen Effekt geführt: Obwohl das deutsche BIP so stark eingebrochen ist wie in keiner anderen Rezession seit den 70er Jahren, ist die Beschäftigung sogar leicht gestiegen – während sie in den anderen Rezessionen meist klar gefallen ist. (siehe Herzog-Stein und Seifert) Die Unternehmen haben in diesem Abschwung vor allem auf „interne Flexibilität“ gesetzt, wie Arbeitsmarktökonomen das etwas sperrig nennen. „Interne Flexibilität“ bedeutet, dass die Anpassung an den Markt und die Konjunktur nicht über Entlassungen stattfindet, sondern über flexiblere Arbeitszeiten und Löhne innerhalb der Unternehmen. Passt man sich so an die Konjunktur an, müssen Mitarbeiter nicht entlassen und in die ökonomische Unsicherheit gestoßen werden.
Auch das weist darauf hin, dass die Arbeitsmarkt-Reformen wenig mit dem Beschäftigungserhalt in der Krise zu tun hatten. Denn viele dieser Reformen – etwa der Leiharbeit, Minijobs etc. – zielten darauf ab, Arbeitnehmer leichter entlassen zu können, nicht darauf, sie flexibler weiter zu beschäftigen, wenn es mal schlecht läuft. Das deutsche Arbeitsmarktwunder spricht dafür, dass es wenig Sinn hat, den Arbeitsmarkt weiter von außen zu flexibilisieren, etwa indem der Kündigungsschutz gelockert wird. Die Sozialpartner in den Unternehmen haben gezeigt, wie sie Beschäftigung erhalten können. Die Mechanismen, die so etwas möglich gemacht haben, sollten daher eher gestärkt werden anstatt Tarifverträge oder den Kündigungsschutz auszuhöhlen.
Unternehmen in anderen Ländern – wie den USA, Spanien oder Irland – entlassen schneller ihre Leute. Dementsprechend ist dort ist die Arbeitslosigkeit trotz vergleichbarer oder sogar geringerer Wachstumseinbußen viel stärker als in Deutschland gestiegen. Auf diesen von so vielen deutschen Ökonomen herbeigesehnten Hire-and-Fire-Arbeitsmärkten sind die sozialen Folgen der Krise viel schlimmer als in Deutschland. In den USA lag die Arbeitslosigkeit im Mai bei knapp zehn Prozent, in Irland bei über 13 Prozent und in Spanien gar bei zwanzig Prozent (siehe OECD Factblog).
Übrigens wäre Arbeitszeitverkürzung vielleicht auch mittelfristig eine gute Idee für den Beschäftigungserhalt und -aufbau. Noch ist die Konjunkturkrise nicht ausgestanden. Aber selbst wenn, so kann es noch lange dauern, bis die Kapazitäten der Unternehmen voll ausgelastet sein werden. Dazu kommen die Risiken der Weltwirtschaft. Der Export trägt weiterhin das deutsche Wachstum, und damit ist die Entwicklung der Weltwirtschaft zentral für die Arbeitsplätze in Deutschland. Vielleicht stellt sich die Weltwirtschaft als robust und etwa China als neue weltweite Konjunkturlokomotive heraus, die die USA als großen Importeur ablösen kann. Wenn nicht, sind Wachstum und Beschäftigung weiterhin in Gefahr. Der Arbeitsmarkterfolg in der Krise hat allerdings gezeigt, dass weniger arbeiten nicht nur den täglichen Arbeitsstress reduzieren hilft, sondern gleich noch Beschäftigung erhält.