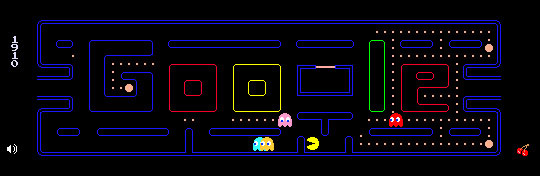Gestern hat die Welt Kompakt ihre „Scroll-Edition“ herausgebracht, die von Bloggern gestaltete Ausgabe ihrer kompakten Tageszeitung. Die Resonanz auf das Experiment fiel gemischt aus, längst nicht alle Blogger sind stolz auf die Arbeit ihrer beteiligten Kollegen. Hier ein Blick in eine kleine Blog-Presseschau:
„Das Experiment ist denke ich gelungen. Die Text(brocken) sind gut, wenn auch mehr einer (kleinen) Wochenzeitung gerecht, als einer Tageszeitung“, findet Thomas Gigold von Medienrauschen.
„Experiment gescheitert“ vermeldet indes Meetix. „Ich frage mich schon seit langer Zeit, wo viele Blogger die Arroganz hernehmen, Journalisten anzugreifen und sie zu verbessern, obwohl diese ihren Beruf von Grund auf gelernt haben und täglich einsetzen.“ Zwei gewichtige Kritikpunkte in dem Blogeintrag lauten: „News von gestern anstatt News von morgen“ und: „Altbekannte Themen neu verpackt“.
Auch das Blog Basic Thinking hält nicht hinter dem Berg mit Kritik, wenn auch zunächst nur unter Bauchschmerzen: „Es fällt mir nicht leicht, diese Zeilen zu schreiben. Zum einen bin ich niemand, der gerne etwas verreißt, wofür sich andere viel Mühe gegeben haben. Weniger nörgeln, mehr machen, ist eigentlich meine Devise“, schreibt der Autor. Und weiter: „Zum anderen diskreditiere ich damit meinen eigenen Berufsstand. Aber Wahrheit bleibt Wahrheit, und die muss gesagt werden.“ Und die lautet: Experiment grandios gescheitert. „Die Expedition hat der deutschen Webszene eher geschadet als genutzt.“
Basic Thinking ist nicht das einzige Blog, das sich vor allem über das besondere Format der Scroll-Editon wundert – ein Querformat nämlich: „Soll ausgerechnet das darauf hinweisen, dass es diesmal eine Internet-gerechte Zeitung ist? Aber wer bitte liest Texte auf diese Weise? Welches Blog hat ein solches Format?“ Insgesamt bleibt Basic Thinking das Layout „die ganze Ausgabe über ein Rätsel. Hat man etwa die Setzer auch nach Hause geschickt und die Blogger ein bisschen mit dem Redaktionssystem spielen lassen?“ Die Texte klebten an den Fotos und würden optisch nahezu davon überlagert.
Es gibt aber auch ein paar positive Gegenmeinungen, die finden: „Lässt sich gut lesen. Würde ich gerne öfter sehen.“
Immer wieder taucht der Kritikpunkt auf, dass der Nachrichtenpart der Blogger-Ausgabe viel zu schwach dahergekommen sei, und die Edition also nicht den Ansprüchen einer tagesaktuellen Zeitung gerecht werden könne. Medienrauschen – insgesamt zufrieden mit der Textqualität – resümiert es so: „Blogger können mit Journalisten. Nur Leser mit dem Anspruch “Tageszeitung” können noch nicht so gut mit Bloggern …“ Oder wie Gerhard Kürner es ausdrückt: „Für 23 Blogger wurde die Produktion zur Lehrstunde über die Beschränkungen, denen eine gedruckte Tageszeitung unterworfen ist.“
Viele Beteiligte, überwiegend zufrieden mit ihrem Werk, schildern die Arbeit als eine Mischung aus Chaos und Spaß: „Die iPads flogen nur so durch die Gegend, während wir inmitten pulsierender Gehirne saßen und einmal mehr merkten, wie unterschiedlich die Bewohner des Netzes doch so sind und wie vielfältig ihre Intuitionen, Wünsche und Meinungen.“
Und sie gestehen: „War gar nicht so einfach.“
Andere sehen die Schuld für die schwachen Ergebnisse des Experiments eher bei den Strukturen und der mangelnden Gestaltungsfreiheit. Der Beitrag auf Turi2 etwa heißt: „Blogger mit begrenzter Macht.“
Immerhin ringt sich ein weiterer Beteiligter, Alex Kahl alias der Probefahrer, sogar ein paar nette Worte über Journalisten ab: „Eine Sache habe ich für meinen Teil in dem Experiment mal GANZ deutlich gelernt. Eine gehörige Portion Respekt und Demut vor dem Job des Journalisten insbesondere was die nachrichten angeht. Denn ich habe mich freiwillig für das News-Team gemeldet. (…) Hölle, war das ein Stress!“
Und die Autorin von Gesellschaft ist kein Trost hatte einen so tollen Tag mit den Journalisten und Blogger-Kollegen, dass sie großzügig „Watschn“ an die kritischen „Neidblogger“ verteilt: „Ich zieh Euch die Hand so heftig über Eure kleinen, hellen Wangen (weil ihr ja nie rausgeht, ihr kleinen Nerds), dass ihr noch drei Tage rote Striemen im Gesicht haben werdet.“
Deutlich nüchterner schließlich die Zusammenfassung vom Czyslansky-Blog: „Für einige Blogger mag das alles eine nette Redaktionsbesichtigung gewesen sein. (…) Die Springer-Redakteure haben mal einige ‚echte Blogger‘ gesehen und vielleicht feststellen können, dass auch diese des Schreibens durchaus mächtig sind. Weitere Lerneffekte aus diesem ‚Experiment‘ blieben und bleiben wohl aus.“
Dafür gibt es hier einen versöhnlichen Vorschlag zum Schluss: „Eine aktuelle Ausgabe, gemacht in Kooperation von klassischen Redakteuren UND Bloggern wäre wohl eine bessere Alternative gewesen.“