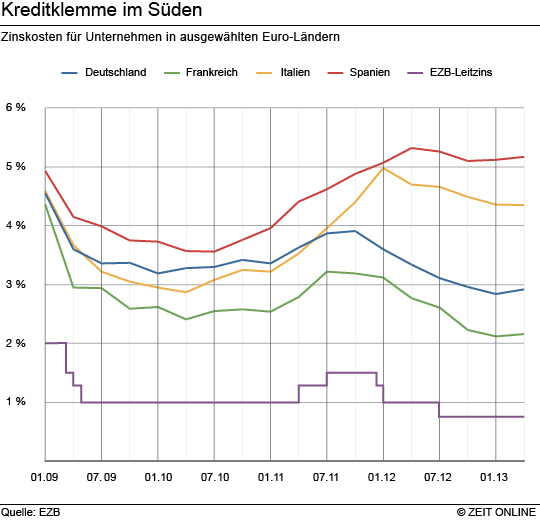Weltweit versuchen Staaten, ihre Verschuldung abzubauen und die Steuern zu erhöhen. Doch die Besteuerung von Firmen ist ein Balanceakt. Die Steuersätze dürfen nicht zu niedrig sein – sonst bringt die Steuer nichts. Sie dürfen aber auch nicht zu hoch sein – sonst verscheuchen sie die Firmen. Für einige Länder haben sich niedrige Steuersätze zum Geschäftsmodell entwickelt. Sie hoffen darauf, langfristig zu profitieren, indem sich Unternehmen ansiedeln, Arbeitsplätze geschaffen werden und so Einkommenssteuern gezahlt werden.
Das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) erstellt jedes Jahr exklusiv für die EU-Kommission eine Übersicht der aktuellen Unternehmenssteuersätze in der EU. Sie zeigt die Effektivsteuersätze in den 27 EU-Staaten sowie in den USA, Japan, der Schweiz, Türkei und Norwegen. Der Indikator „Effektivsteuersatz“ setzt sich aus zwei Größen zusammen: dem reinen Steuersatz sowie der Bemessungsgrundlage. Sie gibt etwa an, wie großzügig Abschreibungen möglich sind.
Das Diagramm verdeutlicht die Kluft zwischen den EU-Staaten. Auf der einen Seite stehen vor allem osteuropäische Staaten wie Bulgarien, die mit extrem niedrigen Steuern locken. Ihnen gegenüber stehen Länder wie Frankreich, Deutschland oder Italien mit teilweise drei Mal so hohen Belastungen. Zwar gebe es seit Jahren den generellen Trend sinkender Steuersätze für Firmen, sagt Jost Heckemeyer, Steuerspezialist der Universität Mannheim. Seit Ausbruch der Finanzkrise habe sich aber dieses „race to the bottom“ verlangsamt, schließlich sorgten sich alle Staaten um ihre Einnahmen.
Bei einigen Ländern lohnt sich ein genauerer Blick: Laut Tabelle erreicht Malta mit 32,2 Prozent den zweithöchsten Effektivsteuersatz in der EU. Wie kann das sein, wo Malta doch als klassisches Steuersparland gilt? Die Antwort liegt in einem besonderen Kniff, den die maltesischen Steuergesetze vorsehen: Erst einmal veranschlagen sie einen hohen Effektivsteuersatz. Doch Anteilseigner können sich die gezahlten Unternehmenssteuern erstatten lassen, wenn ihre Dividenden ausgeschüttet werden.
Mit einem Effektivsteuersatz von gerade einmal neun Prozent fällt Bulgarien auf. Das ärmste Land der EU will sich durch niedrige Steuern attraktiv für ausländische Unternehmen machen. Es setzt auf eine Flatrate: Der Körperschaftssteuersatz liegt bei gerade einmal zehn Prozent. Das ist niedrig genug, um vor allem Firmen aus den Nachbarländern Griechenland und Rumänien anzulocken. Sie siedeln sich direkt am Grenzgebiet an. Neben Bulgarien wirbt auch Zypern mit einer Flatrate von zehn Prozent auf Unternehmensgewinne.
Trotz der Diskussion um Steuerdumping hält Irland an seinem niedrigen Steuersatz von 12,5 Prozent für Einkünfte fest. Allerdings ist die Bemessungsgrundlage relativ restriktiv geregelt, Abschreibungsregelungen sind im Verhältnis zu anderen Staaten ungünstiger. Daher liegt der effektive Durchschnittssteuersatz bei 14,4 Prozent. Im Unterschied zu seinem Nachbarn Großbritannien hat Irland im November 2010 seine Patentbox abgeschafft: Bis dahin waren Einkünfte aus der Verwertung von Patenten steuerfrei. Das machte Irland vor allem für Firmen wie Apple oder Google interessant, die sich dort ansiedelten. Inzwischen bieten sieben andere EU-Staaten ebenfalls Patentboxen an: Belgien, Luxemburg, Malta, die Niederlande, Spanien, Ungarn und Zypern.
Die Patentboxen stoßen auch auf großes Interesse im Nachbarland Großbritannien. Das Land ist für seine aggressive Steuerpolitik bekannt, Premierministerin Margaret Thatcher senkte in den achtziger Jahren die Steuersätze von mehr als 50 Prozent auf 35 Prozent. Dieser Trend setzt sich auch heute noch fort: Bis 2014 will die Regierung die Unternehmenssteuern um drei Prozentpunkte auf 22 Prozent senken. Die geplante Neuregelung der Patentboxen ist vor allem für Pharma- und IT-Konzerne interessant. Im Frühjahr will London, wie Irland, eine Patentbox mit einem ermäßigten Steuersatz von zehn Prozent einführen.
In Frankreich haben dagegen hohe Steuern eine Tradition. Vor allem auf Vermögenswerte greift Paris gern zu. Es erhebt neben der Körperschaftssteuer eine Grundsteuer auf betriebliche Immobilien, kombiniert mit einer Wertschöpfungssteuer, die sämtliche Einkommen aus Produktion besteuert, neben Gewinnen also auch Fremdkapitalzinsen und Gehälter. Auch die Unternehmenssteuern sind im europäischen Vergleich recht hoch. Sie liegen bei 33,33 Prozent und erhöhen sich auf 34,43 Prozent für größere Unternehmen.
Deutschland liegt mit einem Effektivsteuersatz von 28,2 Prozent schon seit Jahren oberhalb des EU-Durchschnitts. Zum letzten Mal reformierte die Bundesregierung die Unternehmenssteuern im Jahr 2008 und senkte unter anderem die Körperschaftssteuer von 25 Prozent auf 15 Prozent. Die Steueroasen in Europa sind Bundesfinanzminister Schäuble ein Dorn im Auge. Er kündigte eine Initiative der OECD an, um die aggressiven Steuersparmodelle von Firmen weltweit einzudämmen.