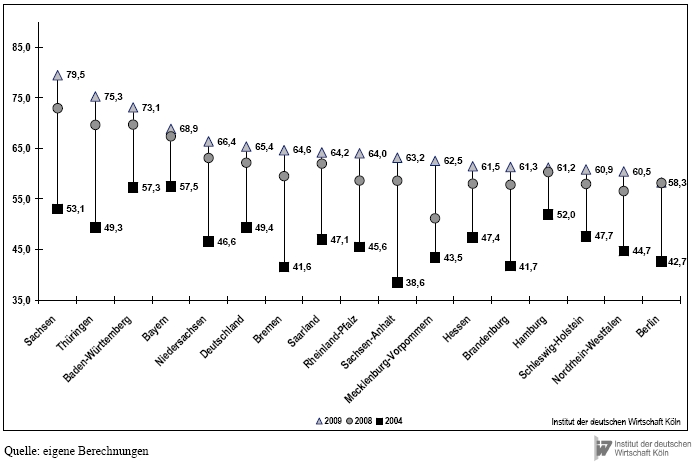Angela Merkel möchte, so ist derzeit zu lesen, Peer Steinbrück aus Dankbarkeit für die gute Zusammenarbeit beim Management der Finanzkrise für einen prestigeträchtigen Job vorschlagen, falls die SPD nach der Bundestagswahl nicht mehr an der Regierung beteiligt sein sollte. Und wie bei fast allen politischen Meldungen dieser Tage stellt sich die Frage: Hat das Auswirkungen auf den Wahlkampf?
Angela Merkel möchte, so ist derzeit zu lesen, Peer Steinbrück aus Dankbarkeit für die gute Zusammenarbeit beim Management der Finanzkrise für einen prestigeträchtigen Job vorschlagen, falls die SPD nach der Bundestagswahl nicht mehr an der Regierung beteiligt sein sollte. Und wie bei fast allen politischen Meldungen dieser Tage stellt sich die Frage: Hat das Auswirkungen auf den Wahlkampf?
Jedenfalls passt die Nachricht ins Bild des bisherigen Wahlkampfes der Bundeskanzlerin, der zuletzt als zu wenig aggressiv und konfrontativ kritisiert wurde. Vor diesem Hintergrund sehen vermutlich einige Wahlkämpfer diesen neuen Beweis für das trotz jüngster Attacken bis zuletzt gute Klima in der Großen Koalition kritisch. Auch mancher (Nicht-)Wähler könnte sich in seiner Meinung bestätigt sehen, dass es zwischen den Parteien und ihren Kandidaten keine klaren Unterschiede gibt. Aus dieser Perspektive könnte man vermuten, dass hier eine interne Absprache zwischen Merkel und Steinbrück ungewollt nach außen gedrungen ist.
Möglicherweise steckt aber auch ein gewisses Kalkül dahinter, dass diese Information schon heute (also vor und nicht erst nach der Wahl, wenn Personalfragen üblicherweise verhandelt werden) aus dem CDU-Umfeld an die Öffentlichkeit gelangt ist. Immerhin stellt eine solche Nachricht die Kanzlerin einmal mehr als Staatsfrau dar, die jenseits der Parteigrenzen agiert und – ganz im Sinne des Volkes, das Steinbrücks Krisenmanagement schätzt – gute Arbeit ungeachtet des Parteibuches belohnt. Dieses Bild passt zur Wahlkampfstrategie der Union, die bisher vor allem auf die überparteiliche Beliebtheit der Person Angela Merkel und ihre damit verbundene Strahlkraft auf die anderen politische Lager ausgelegt war.
Schon Gerhard Schröder hat sich eines ähnlichen Kunstgriffes bedient, als er in seiner Regierungszeit zwei Kommissionen unter der Führung prominenter Unionspolitiker, Rita Süßmuth und Richard von Weizsäcker, einsetzen ließ. Auch dies war nicht zuletzt ein Versuch, sich gerade im Unionslager als „Kanzler aller Deutschen“ zu profilieren. Und tatsächlich stand Schröder zumindest phasenweise auf einer Stufe mit Kanzlern wie Konrad Adenauer oder Helmut Schmidt, deren persönliche Beliebtheit sehr tief in das gegnerische politische Lager hineinreichte.
Für Angela Merkel bietet sich nun die Möglichkeit, kurzfristig noch auf ähnliche Weise im Lager der SPD zu punkten. Laut aktuellem Politbarometer stehen nur 60% der SPD-Anhänger hinter Spitzenkandidat Frank-Walter Steinmeier, im Vergleich dazu unterstützen 92% der CDU/CSU-Anhänger die Kanzlerin. Hier ist aus Sicht der Union großes Potenzial für eine Kampagne vorhanden, die sich gerade an jene SPD-Anhänger richtet, die aufgrund des Kandidatenfaktors noch nicht sicher sind, wo sie ihr Kreuz setzen werden. Wenn gerade diesen Wählern demonstriert werden könnte, dass sozialdemokratische Spitzenpolitiker wie Peer Steinbrück auch unter einer schwarz-gelben Regierung zur Geltung kommen würden, könnte dies Angela Merkel und der CDU wertvolle Stimmen einbringen.