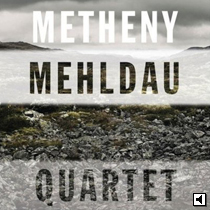Jeden Morgen vor dem Musizieren machen die Musiker von !!! gemeinsame Kung-Fu-Übungen in Unterhosen. Soviel Beweglichkeit zahlt sich aus, ihr neues Album „Myth Takes“ fegt lockeren Fußes über die Tanzflächen.
Aus einer dunklen Ecke der Tanzhalle wankt einer hinüber zum DJ-Pult. Er fragt, was da gerade läuft. Der DJ sagt spuckend so etwas wie „tschik tschik tschik“. „Hä?“ Der DJ schreit zurück: „Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen“, malt diese mit dem Finger in die Luft. Er wünscht sich ein Schild mit drei Ausrufezeichen, das könnte er dann hochhalten. Wahrscheinlich verstünde das aber auch niemand.
!!!, welch ein Name. Um in Suchmaschinen etwas über die Band zu finden, muss man chk chk chk eingeben, so wird das meistens ausgesprochen. Weiß man das, dann erfährt man, dass die Gruppe aus Kalifornien kommt und gerade ihr drittes Album Myth Takes veröffentlicht hat. Man darf sie auch pow pow pow oder bam bam bam nennen, Hauptsache dreimal dasselbe einsilbige Wort. Viel weiter unten liest man, dass das aus dem Film Die Götter müssen verrückt sein kommt, dort wurden rhythmische Laute von Ureinwohnern in der Kalahari-Wüste mit „!!!“ übersetzt.
Früher verfingen sie sich oft in langen Stücken. Auf Myth Takes dominieren klare Strukturen mit Strophe und Refrain, es klingt geordneter, gezügelter. Keine „shit, scheiße, merde“-Gesänge mehr, dafür soulige Frauenstimmen und Rhythmen, die durch den Hintern galoppieren. Rockende Gitarren und Schlagzeuge verschmelzen mit wummernden Clubgeräuschen. Und das so sexy, man muss dazu tanzen. Schon ihr letztes Album Louden Up Now war so clubtauglich, dass der Techno-DJ Sven Väth es zu einer seiner liebsten Platten kürte.
Hier geht es um Rhythmen, erzeugt mit Hilfe elektronischer und gedroschener Schlagzeuge. Drumherum Bläser, selbstversunkene Gitarren, Klanggewirr und Glocken, Punk, Rock und Funk. Das alles nie zu sauber. Die Stücke bauen sich auf, explodieren im Klanggewirr und werden dann plötzlich runtergebrochen. Als wäre der Tänzer gestolpert und würde nun auf der Tanzfläche sitzen. Dann steht er wieder auf und tanzt umso ekstatischer weiter. Gucken ja jetzt sowieso alle.
Geschichten gibt es wenige über die Band. Weder verbreiten die Musiker eine spektakuläre Version ihres Kennenlernens, noch Mythen über Drogenexzesse oder Hotelverwüstungen. Allein die Entstehungsgeschichte von Myth Takes wird wohldosiert der Öffentlichkeit preisgegeben. Für die Aufnahmen hatten die acht Musiker sich gemeinsam ein Haus gemietet, jeden Morgen vor dem Musizieren absolvierten sie gemeinsam Kung Fu-Übungen in Unterhosen. Folglich gibt es auch lustige Werbefotos zur Platte.
Auch auf der Bühne seien !!! großartig. Bei solchen Gelegenheiten werde getanzt, wie sonst nur in der Technodisko, heißt es. Im April kann man das selbst überprüfen, da ist die Band zu vier Konzerten in Deutschland.
„Myth Takes“ von !!! ist als CD und Doppel-LP erschienen bei Warp/Rough Trade
Hören Sie hier ![]() „Heart Of Hearts“
„Heart Of Hearts“
…
Weitere Beiträge aus der Kategorie ROCK
The Fall: „Reformation! Post-TLC“ (Slogan/Sanctuary 2007)
Arcade Fire: „Neon Bible“ (City Slang 2007)
Kaiser Chiefs: „Yours Truly, Angry Mob“ (B-Unique/Universal 2007)
Do Make Say Think: „You, You’re A History In Rust“ (Constellation 2007)
Sonic Youth: „Goo“ (Geffen 1990)
Alle Musikangebote von ZEIT online finden Sie unter www.zeit.de/musik