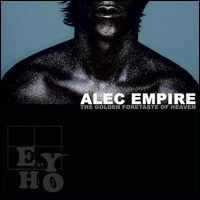Der Berliner Alec Empire spielt Rock ohne Gitarren. Das Wummern der Synthesizer auf „The Golden Foretaste Of Heaven“ bringt sogar den binären Code zum Tanzen.
Null und Eins treffen sich im Club.
Eins: „Wer spielt denn?“
Null: „Alec Empire. Kennst du den?“
Wie aus dem Nichts tritt ein Musikkritiker hinzu.
Kritiker: „Wenn ich mich kurz einmischen darf …“
Eins: „Na, wenn’s denn sein muss.“
Kritiker: „Danke. Also, früher hat er bei Atari Teenage Riot gespielt, einer Radauband aus Berlin. Unhörbar, sag ich euch. Ein Chaos aus digitalem Lärm und Gekreische, dabei verdampften Gehirnwindungen und Schaltkreise. Ein bisschen Punk und viel Techno. Seit fünf Jahren macht er allein Musik und hat Dutzende anderer Musiker produziert. Irre.“
Eins: „Aha.“
Die ersten Töne von New Man scheppern los. Klotziger Takt, rotzige Klänge, es klingt gar nicht nach Techno.
Null: „Das ist jetzt aber rockig. Sind das E-Gitarren?“
Kritiker: „Nein, nein, er benutzt keine Gitarren. Das sind alles Synthesizer. Russische.“
Alec Empire: „Keep on Dancing.“
Die Stimme sägt aus den Lautsprechern, Ice heißt das nächste Lied, „Three Strokes of A Razor“, singt Empire. Der Musikkritiker postuliert, das klinge nach dem englischen Rock’n’Roll der Siebziger, und die Melodie sei von Gary Numan abgekupfert. Aber niemand hört ihm zu.
Dann steht er an der Bar. Versucht jemanden zu beeindrucken. Digitales Kreischen legt sich über den Saal, die Musik wird langsamer. Fast kuschelig, würde es nicht stets fiepen, von oben, von unten, von überall her. Kleine Stromschläge durchzucken 1000 Eyes. Sieben Minuten lang.
Kritiker: „Eigentlich heißt er ja Alexander Wilke. Hat mit 14 angefangen mit Musik, erst Gitarre, dann Computer, erst Charlottenburg, dann London. Jetzt ist er 35. Wollte damals den Techno politisieren, das waren die Neunziger. Inzwischen ist er viel braver geworden, das hat alles Rockstruktur, Strophe und Refrain. Weißt du, das ist eigentlich eine Liebesplatte! Keine Rebellion mehr, keine Parolen, wie damals mit Atari Teenage Riot. Zehn Lieder, neunmal geht’s um Frauen, einmal um Satan. Das hab ich recherchiert.“
Jemand: „Waaas?“
Ein elektronischer Rhythmus schlägt Purzelbäume, rast über schrille Tonflächen, stolpert nie. Das Schlagzeug stampft dahinter. Down, Satan, Down.
Alec Empire: „Come on Satan, drag me down! Down!“
Satan: „Oh yeah.“
Schweiß tropft über die Knöpfchen auf der Bühne. Null und Eins tanzen und zappeln, sie können nicht schwitzen, sind ja nur Zahlen. Die Bässe von On Fire dröhnen in die Lendengegend, beinahe ist das glitzernder Glam-Rock. Eins und Null trinken Sekt auf Eis. Das passt am besten.
Alec Empire (noch verzerrter): „We make love for hours and hours.“
Hormone: „Sind wir zu spät?“
Null: „Gerade richtig, jetzt kommt Robot Love. Das pluckert ganz entspannt.
Eins: „Kenn ich! Das war eine Single im vergangenen Jahr.“
Kritiker: „Ja, das war die erste Platte auf seinem Label Eat your Heart Out.“
Später am Abend. Null und Eins trinken um die Wette, schwitzen jetzt auch, sind aus der Puste. Der Musikkritiker sitzt beseelt am Tanzflächenrand. Bug On My Windshield wummert unerbittlich. Wütend schwillt es an, der Synthesizer pfeift dazwischen. Es hat nicht viel Text.
Alec Empire: „You’re a bug on my windshield.“
Null: „Jaja, Liebesplatte, jaja.“
Kritiker: „Wartet doch den nächsten Song ab. No/Why/New York, eine Ballade. Dazu könnt ihr schwofen.“
Eins: „Aber nicht mit dir.“
Die Hormone holen ihre Jacken, hier gibt’s nichts mehr zu tun. Die Musik geht von vorne los.
Sonne: „Ich geh jetzt auf.“
Alle: „Uns doch egal.“
„The Golden Foretaste Of Heaven“ von Alec Empire ist als CD und Doppel-LP bei Eat Your Heart Out/Cargo erschienen.
…
Weitere Beiträge aus der Kategorie ROCK
Neil Young: „Dead Man“ (Vapor Records/Warner Music 1996)
Karate: „595“ (Southern Records 2007)
Nevada Tan: „Niemand hört dich“ (Vertigo/Universal 2007)
Codeine: „The White Birch“ (Sub Pop 1994)
Porcupine Tree: „Fear Of A Blank Planet“ (Roadrunner Records/Warner 2007)
Alle Musikangebote von ZEIT online finden Sie unter www.zeit.de/musik