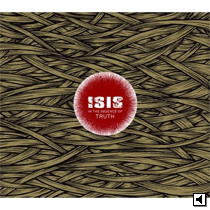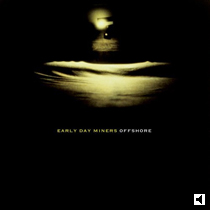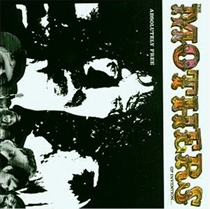Die vier Musiker von Milburn sind noch jung, trotzdem klingt „Well Well Well“, als hätten sie jede Rockplatte der letzten 30 Jahre gehört. Hier leihen sie eine Melodie, dort klauen sie einen Rhythmus
Ganz einfach ist es nicht mehr, poppige Rockmusik mit Siebziger-Anleihen zu machen und dabei originell zu klingen. Auch Milburn machen nichts wirklich Neues. Aus ihren Stücken klingen abwechselnd Franz Ferdinand durch und die Strokes, Razorlight und Maximo Park. Und die Arctic Monkeys natürlich auch, denn die klangen ja selbst schon wie eine Mischung ihrer Vorgänger.
Aber Milburn machen das gut, sie kombinieren die Einflüsse unterhaltsam und schreiben feine Lieder. Das Meiste ist ziemlich elegant geklaut. Oder geliehen. Die Gitarren sind ruppig und meistens – Franz Ferdinand hatten das wieder kultiviert – Stereo aufgenommen. Im Kopfhörer kommt von jeder Seite eine andere Gitarrenmelodie, ein sehr schöner Effekt. Die Melodien sind mal abgeklärt wie bei den Strokes, mal euphorisch punkig. Die Rhythmen erinnern hier an The Clash – die Saiten auf die Zwei im Takt nur kurz angerissen – dort an das gelassene Spiel von Maximo Park.
Joe und Louis Carnall, Tom Rowley und Joe Green sind Milburn, die Vergleiche kümmern sie wenig. „Nur eine Frage ist uns wichtig: Ist es ein guter Song?“, sagt Sänger Joe Carnall. Eine Frage, die sich beim Durchhören ihres ersten Albums Well Well Well beinahe durchgängig mit Ja beantworten lässt. Die vier Musiker sind zwischen 18 und 20 Jahren alt und spielen seit fünf Jahren zusammen, sie kommen aus Sheffield. Ja, genau wie die Arctic Monkeys, mit denen sind sie auch befreundet, heißt es. Da droben im Norden spricht man ein drolliges Englisch. Something klingt wie summfinn, wrong wie rrrung, rough wie rrruff. Das U wird auch wie ein U ausgesprochen, und sie singen much von guns, fucking und fuss.
Aber was hat man mit kaum 20 zu erzählen? Milburn zumindest nicht zu viel von dem üblichen Liebes- und Herzschmerz-Tralala. Sondern zum Beispiel die belehrende Geschichte eines gestohlenen Mobiltelefons in What About Next Time?: „I try to say you’re doing wrong but you chose to ignore me.“ Was, wenn nächstes Mal etwas Schlimmes passiert? Ihre Beziehungsgeschichten stecken voller Sarkasmus, „Things get broken, things come clear / If you wanted to leave so much then why are you still here?“ (Cheshire Cat Smile). Hier und da spielen sie auf Klassiker an, in What You Could’ve Won zitieren sie Ignorance Is Bliss von den Ramones, „You kick me into touch and I fall / I fall to the floor / And all I wanted was a kiss / All I wanted was a chance tonight / But yeah your ignorance was bliss / Your ignorance was paradise“.
Ihre erste Single Send In The Boys handelt von einer Entführung, ein bisschen simpel, aber na ja. „He had her down in the cellar with a knife at her throat / he wouldn’t let her go oh no.“ Das Musikvideo zu dem Stück illustriert die Geschichte, ein gut geschminktes Mädchen sitzt in einem Keller, die Band musiziert in einem anderen, Polizisten jagen den Entführer und – wer hat’s geahnt? – verhaften am Ende die Musiker. Ach ja, die sehen natürlich die ganze Zeit sehr gut aus. Kurz nach der Veröffentlichung wurden sie gefragt, wie sie sich ihren Erfolg erklären: „In unserem Musikvideo kommen Pistolen vor“, guns, mit u.
Manchmal könnten sie ruhig ein bisschen mehr Humor vertragen. In Showroom besingen sie einen Menschen, der ihnen auf die Nerven geht: „And it makes me laugh, he’s trying so hard to pretend / Acting oh so original when he’s simply following the trends“, haha, Eigentor.
„Well Well Well“ von Milburn ist als CD erschienen bei Mercury/Universal
Hören Sie hier ![]() „Send In The Boys“
„Send In The Boys“
…
Weitere Beiträge aus der Kategorie ROCK
Isis: „In The Absence Of Truth“ (Ipecac 2006)
Mouse On Mars: „Varcharz“ (Ipecac/Sonig 2006)
Sid Le Rock: „Keep It Simple, Stupid“ (Ladomat 2006)
Early Day Miners: „Deserter“ (Secretly Canadian 2006)
Can: „Tago Mago“ (Spoon Records 1971)
Alle Musikangebote von ZEIT online finden Sie unter www.zeit.de/musik