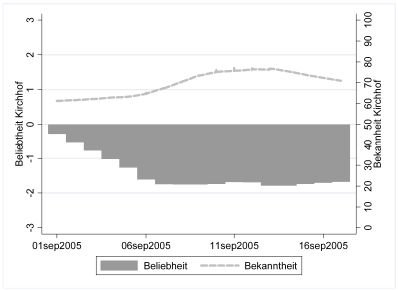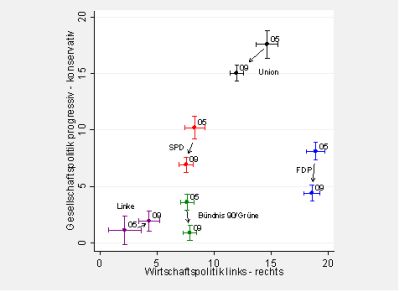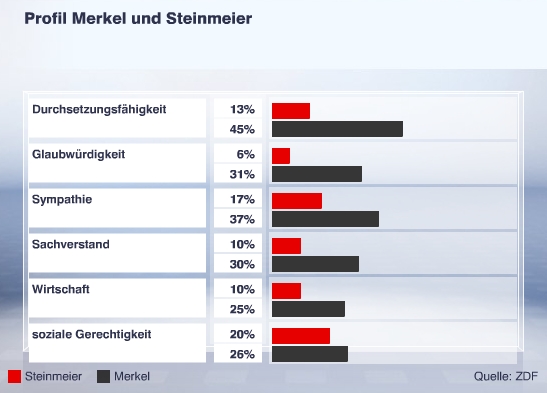Der verstorbene frühere FDP-Vorsitzende Otto Graf Lambsdorff nannte einmal ein hübsches Beispiel für eine Journalistenfrage, die Politiker besser nicht beantworten sollten: „Haben Sie aufgehört, Ihre Frau zu schlagen?“ Sagt der Politiker darauf ohne Nachzudenken „Ja“, bestätigt er indirekt, dass er ein gewalttätiger Ehemann ist. Sagt er hingegen „Nein“, weil er die Frage für absurd hält, outet er sich erst recht als Schläger.
Ähnlich verhält es sich mit dem in Wahlkampfzeiten beliebten Fragespiel: „Schließen Sie eine Koalition mit der Partei XY aus?“ Was soll ein Politiker, der halbwegs bei Trost ist, dazu anderes sagen außer einer Standard-Floskel in der Art: „Wir streben eine Koalition mit der Partei Z an. Aber wenn der Wähler anders entscheidet, werden wir uns Gesprächen mit anderen demokratischen Parteien nicht verschließen.“ Nur Politiker, die eigentlich gar nicht regieren wollen, werden die Frage bejahen.
Auf diese Weise kamen dieser Tage mal wieder Schlagzeilen zustande, Kanzlerin Merkel und Politiker der SPD schlössen eine Große Koalition im Fall der Fälle nicht aus, und führende Grünen liebäugelten heimlich mit Schwarz-Grün. Ja, was denn sonst? Sollen sie behaupten, sie gingen auf jeden Fall in die Opposition, wenn es für Schwarz-Gelb bzw. Rot-Grün bei der Bundestagswahl nicht reicht? Besonders der SPD würde man eine solche „Auschließeritits“ angesichts ihrer bescheidenen Umfragewerte als Realitätsverweigerung auslegen.
Also hat sich im Grunde nichts geändert: Die Wähler werden am 22. September nicht über eine Koalition entscheiden, sondern über die Zusammensetzung des Parlaments. Die Parteien werden dann versuchen, aus den entstandenen Mehrheitsverhältnissen eine Regierung zu formen. Das kann kompliziert werden, erst recht, wenn fünf, sechs oder sieben Parteien in den Bundestag einziehen. Deshalb sind alle Parteien gut beraten, sich andere als nur ihre Wunschoptionen offen zu halten, falls sie mitregieren möchten, und sich nicht an eine Partei zu ketten wie die FDP, die vor der Wahl eine Ampelkoalition formell ausschließen will. Und deshalb sollten Politiker bis dahin die unsinnige „Schließen-Sie-aus?“-Frage am besten nicht mehr beantworten. Die Wähler wissen es ohnehin besser.