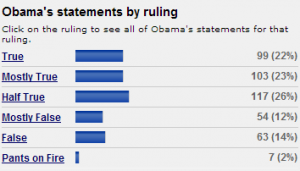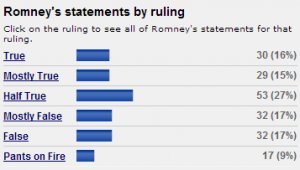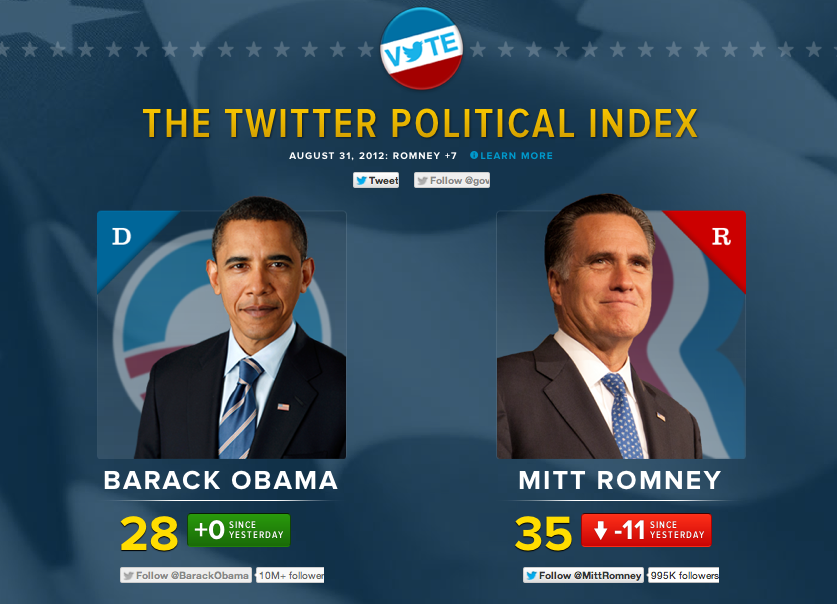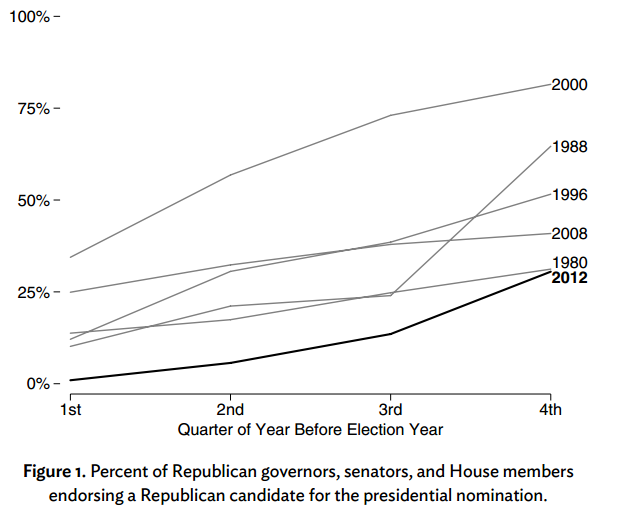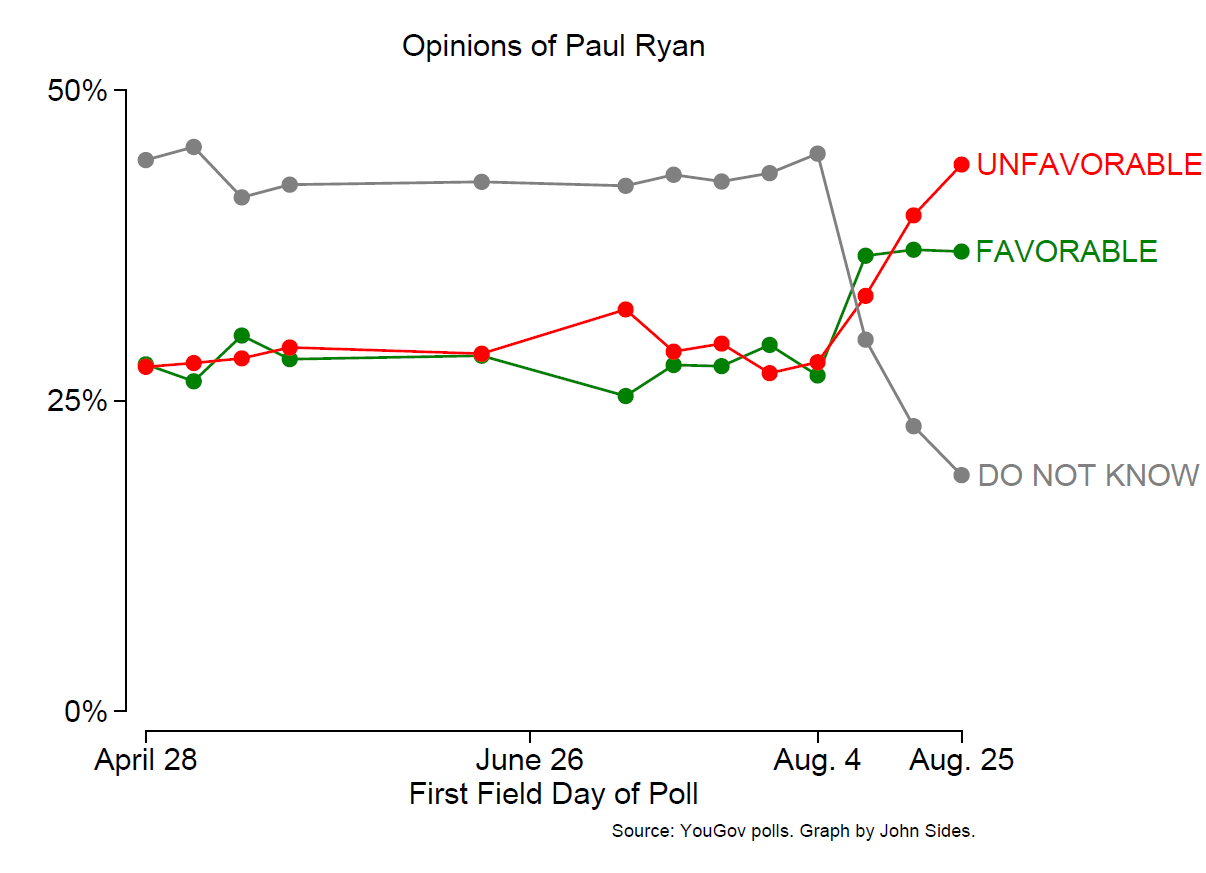Betrachtet man die deutsche Sexismus-Debatte mit einer gewissen Distanz, etwa aus der Perspektive der USA, so wird deutlich, welche Auswirkungen derartige gesellschaftspolitische Diskussionen hier wie dort haben können. Man darf allerdings hoffen, dass die dortigen Regeln der „political correctness“ nicht bald auch hier gelten. Sie entstanden sicherlich mit besten Intentionen. Inzwischen aber haben sie Dimensionen angenommen, die für keinen der Beteiligten hilfreich sind. Statt Respekt und Verständnis füreinander zu fördern, verhärten sie die Fronten bisweilen eher noch.
Am Beispiel Rainer Brüderle zeigt sich: In Deutschland geht man mit solchen Anlässen durchaus anders um als in den USA. Er steht ganz persönlich in der Kritik, doch viele Kommentatoren haben längst und mit Recht angemerkt, dass die Debatte nicht anhand einer bestimmten Person geführt werden sollte. Denn die Beobachtungen, um die es geht, treten im Alltag zuhauf und an ganz unterschiedlichen Stellen auf. Die politische Dimension für Brüderle und die FDP ist verglichen damit zweitrangig.
In den USA hingegen sind gesellschaftspolitische Debatten noch stärker mit Personen verknüpft. Das hat einen bemerkenswerten Effekt: Insbesondere Politiker der Republikanischen Partei „üben“ in diesen Tagen verstärkt das politisch korrekte Auftreten. Der lange Wahlkampf im vergangenen Jahr hat viele unbedachte oder auch tatsächlich respektlose Äußerungen zutage gebracht, die der Partei in der öffentlichen Wahrnehmung und damit auch in der harten politischen Währung der Wählerstimmen nachhaltig geschadet haben.
Rhetorik und politisches Handeln klaffen auseinander
Den Republikanern geht es nun darum, mittelfristig wieder Wählerschichten für sich zu gewinnen, ohne die in Zukunft keine Präsidentschaftswahl mehr zu gewinnen ist: etwa Hispanics, Asiaten – oder eben Frauen. Über diese Gruppen will man nicht mehr herablassend sprechen, einem „Sensitivitätstraining“ sollten sich die Politiker unterziehen, heißt es. Und die selbst auferlegte Maßregelung nimmt absurde Züge an: Beispielsweise ist doch tatsächlich mit Blick auf mittel- und südamerikanische Einwanderer der Ratschlag zu hören: „Don’t use phrases like ’send them all back‘.“ oder; „Don’t characterize all Hispanics as undocumented and all undocumented as Hispanics.“ Dies nur als kleine Kostprobe.
Über diese republikanische Rhetorik wird in den USA gerade viel berichtet. Das politische Handeln auf diesen Themenfeldern findet dagegen oft unterhalb des nationalen (kritischen) medialen Radars statt. So werden etwa in den Staaten, in denen Republikaner reagieren, Abtreibungskliniken geschlossen. Die Amtsträger dort vertreten auch vielfach deutlich frauenfeindliche Standpunkte zu Verhütung oder Gesundheitsvorsorge. Gleichzeitig spricht die Struktur der Abgeordneten im Kongress nicht gerade dafür, dass aktiv Frauen rekrutiert werden. Die Republikaner haben sehr viel weniger weibliche Abgeordnete im Repräsentantenhaus als die Demokraten: Von den 234 Mitgliedern sind lediglich 20 Frauen; bei den Demokraten sind es immerhin 61 von 201 (mehr dazu auch in einer aktuellen Ausgabe der Rachel Maddow Show).
Über konkrete Veränderungen nachdenken
Die Diskrepanz zwischen Rhetorik und tatsächlichen politischen Positionen mag in Deutschland weniger drastisch sein, allerdings besteht sie auch hierzulande. Mit Blick auf die Sexismus-Debatte sollte man vor allem die Politik nicht nur an Worten, sondern auch an Taten messen. Wo bleiben die Frauen in den Aufsichtsräten? Wo bleibt die Quote? Wie steht es mit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf? Warum haben wir im Jahre 2013 immer noch zu wenige Kita-Plätze? Auch dies sind Fragen, die im Zusammenhang mit alltäglichem Sexismus gestellt und beantwortet werden müssen.
Die derzeitige Debatte ist wichtig. Aber ihr ganzes Potenzial entfaltet sie erst, wenn wir sie zum Anlass nehmen, über konkrete Weichenstellungen zu sprechen. Nur dann kann es nachhaltige Veränderungen für unser Miteinander geben. Lasst uns über gesellschaftspolitische Positionen sprechen!