An diesem Donnerstag trifft sich der europäische Zentralbankrat zum letzten Mal in diesem Jahr. Es gäbe gute Gründe, die Zinsen zu senken, sie sind aber aus seiner Sicht nicht stark genug. Immerhin ist aber wohl doch der Punkt erreicht, an dem es nicht mehr darum geht, wann die Zinsen erhöht werden, sondern wann sie gesenkt werden müssen. Die Marktteilnehmer jedenfalls setzen darauf.
Vermutlich ist der Zentralbanksatz von 4 Prozent neutral in dem Sinne, dass er die volkswirtschaftliche Nachfrage weder stimuliert noch bremst und deshalb nicht geändert zu werden braucht. Neutralität entspräche dem Produkt aus mittelfristigem Wachstum des (realen) Produktionspotentials von 2 1/4 Prozent und der angestrebten Inflationsrate von etwas unter 2 Prozent, also etwa 4 Prozent. Das ist keine Formel, wie sie ein echter rocket scientist verwenden würde, aber sie gibt einen guten Anhaltspunkt. Nach Keynes ist es bekanntlich besser, man liegt grob richtig als präzise falsch.
Der Notenbankzins ist ein wichtiger Indikator für die Ausrichtung der Geldpolitik – der reale handelsgewogene Wechselkurs ist ein anderer, zusätzlicher. Die Aufwertung des Euro seit letztem Sommer wird einen massiv restriktiven Effekt auf die Konjunktur haben, so wie eine Zinserhöhung. Wenn ich noch mal eine überschlägige Rechnung machen darf: Eine reale Aufwertung um 5 Prozent ist vergleichbar einer Zinserhöhung um einen Prozentpunkt, womit wir inzwischen, was das monetäre Umfeld insgesamt angeht, tatsächlich bereits im restriktiven Bereich wären. Die Erwartung, dass der nächste Zinsschritt eine Senkung sein dürfte, ist von daher berechtigt. Das Verhältnis 5 zu 1 spiegelt in etwa den Anteil des Außensektors an der Gesamtnachfrage wieder.
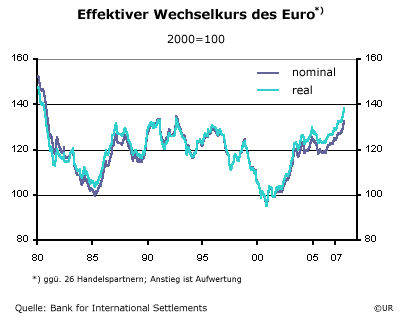
Es überrascht nicht, dass die EZB von solchen Argumenten nichts hören will. Die jüngsten Zahlen zum Arbeitsmarkt oder zum Bruttoinlandsprodukt, aber auch die Umfragen, die sich auf die Konjunkturerwartungen beziehen, sind immer noch ganz robust. Nicht so gut sieht es beim Umsatz des Einzelhandels aus, weil es für die Verbraucher offenbar nicht mehr so leicht ist, Kredite zu bekommen. Auch der Wohnungsbau ist ins Stocken gekommen. Insgesamt ist realwirtschaftlich von der Ölpreisexplosion, der Finanzkrise und dem festen Euro aber noch nicht viel zu spüren.
Zudem liegt natürlich die Inflationsrate bei den Verbraucherpreisen – im November waren es 3,0 Prozent im Vorjahresvergleich – weit über der Zielmarke. Wie glaubwürdig wäre die EZB, wenn sie angesichts solcher Zahlen – sowie, nicht zu vergessen, der Explosion der Geldmengenaggregate – die Zinsen senkte?
Anderseits fragt sich, weshalb die Finanzmärkte so tun, als stünde eine Art Weltwirtschaftskrise bevor, Deflation eingeschlossen. Dazu ein paar Zahlen:
- Normalerweise liegen die Dreimonatszinsen am Geldmarkt um 20 Basispunkte über dem Notenbanksatz, zur Zeit sind es 86 Basispunkte. Die Banken trauen sich gegenseitig nicht mehr über den Weg. Sie rechnen zunehmend damit, dass die Gegenseite in Zahlungsschwierigkeiten geraten wird.
- Das Gleiche bei den Pfandbriefen: Im Zehnjahresbereich übertreffen deren Renditen die von Bundesanleihen normalerweise um 15 Basispunkte, und nicht um 48 so wie jetzt.
- Ähnlich ist es in den USA: geht man nach den Futures-Märkten, wird der Notenbankzins bis zum Sommer nächsten Jahres um einen vollen Punkt auf 3,5 Prozent gefallen sein. Die Renditen der zehnjährigen Treasuries sind auf 3,9 Prozent gefallen und damit trotz des schwachen Dollars und der relativ hohen Verbraucherpreis- und Lohninflation deutlich unter das Niveau der deutschen Bundesanleihen. Das riecht stark nach Panik.
- Auch in Großbritannien hat sich die Finanzkrise in den letzten Wochen wieder deutlich verschärft: der Interbanksatz übertrifft den Notenbanksatz von 5,75 Prozent um nicht weniger als 90 Basispunkte, ein Rekord. Die zehnjährigen Swapsätze (de facto die Renditen von Bankschuldverschreibungen) liegen um 54 Basispunkte über denen der Staatspapiere, die mit 4,5 Prozent wiederum deutlich unter dem Satz der Bank of England notieren.
In den USA sind staatliche Rettungsaktionen für die Hypothekenschuldner in der Diskussion, damit die Subprime-Krise nicht ausufert und eine allgemeine Rezession auslöst. Es darf bezweifelt werden, dass es damit getan sein wird. Innerhalb kürzester Zeit ist nämlich die Liquidität, also die kurzfristige und unlimitierte Verfügbarkeit von Kreditlinien, das Schmiermittel der Marktwirtschaft, ausgetrocknet. Bill Gross, der angesehene Chef der Bond-Fondsgesellschaft PIMCO, spricht bereits von einem Zusammenbruch des modernen Bankwesens. In Großbritannien wiederum sieht sich der Staat gezwungen, die Northern Rock, eine große Hypothekenbank, zu retten, notfalls durch Verstaatlichung. Rettungsaktionen haben wir natürlich auch schon hierzulande gesehen.
Es sollte nie vergessen werden, dass die wichtigste Aufgabe von Notenbanken darin besteht, das Finanzwesen zu bewahren. Das kommt noch vor der Bewahrung der Kaufkraft des Geldes, auch wenn das in normalen Zeiten nie so gesagt wird, weil die Banken sonst nämlich auf dumme Gedanken kommen könnten, also zu leichtfertig Kredite vergeben würden.
Was erstaunt, ist wie positiv nach wie vor die Konjunkturprognosen ausfallen. Nirgendwo werden Rezessionen erwartet. Wenn es aber so ausgeht wie einst in Japan, wenn Banken und Haushalte ihre Aktiva abwerten müssen und auf einmal de facto überschuldet sind, wird es ernst. Dann ist es mit einer kurzen wenn vielleicht auch schmerzhaften Rezession nicht getan. Dann heißt es, auf Jahre die Gürtel enger schnallen und die Verschuldung ab- und das Kapital wieder aufbauen. Sind wir schon an dieser Schwelle angekommen? Noch warten wir auf klarere Signale aus der Realwirtschaft.
Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass die hohen Ölpreise, die Liquiditätsklemme und – bei uns – der feste Euro und die Implosion der südeuropäischen Immobilienmärkte nicht starke negative Auswirkungen auf die Konjunktur haben werden. Klar ist, dass die EZB nicht so recht weiß, wohin die Reise geht. Klar ist aber, dass rasche und entschlossene Zinsschritte erforderlich sein werden, wenn es mehr in Richtung Deflation gehen sollte. Wenn es sich um eine klassische Liquiditätsfalle handeln sollte, was nicht unwahrscheinlich ist, wird auch die Finanzpolitik stärker gefordert sein, als wir es uns gegenwärtig noch vorstellen. Japan war jahrelang gezwungen, Defizite in der Größenordnung von 8 Prozent des BIP zuzulassen, damit die Nachfrage einigermaßen stabilisiert werden konnte. Es könnte auch sein, dass es zu einem Abwertungswettlauf kommt – wenn nämlich alle wichtigen OECD-Länder versuchen durch niedrigere Zinsen ihre Währung zu verbilligen, um damit ihre Beschäftigung zu sichern. So oder so, die Zinsen werden nicht mehr steigen.