Die Regierungen überschuldeter kleiner Länder können, wenn sie nur entschlossen genug sind und von der Bevölkerung unterstützt werden, durch eine Radikalkur innerhalb kürzester Zeit ihre Finanzen in Ordnung bringen und das Vertrauen der internationalen Kapitalmärkte zurückgewinnen, sich also erneut zu relativ niedrigen Zinsen verschulden. Estland und Irland machen es gerade vor, Belgien, Schweden und Finnland ist das Kunststück in der Vergangenheit geglückt, und ich vermute, dass es auch Griechenland, Portugal und sogar Spanien gelingen wird. Ist der Abgrund nur nah genug, lassen sich regelmäßig Maßnahmen durchsetzen, die vorher als unzumutbar galten.
Rolf Schneider von der Allianz hat mir gestern ein Positionspapier von Michael Heise, dem Allianz-Chefvolkswirt, gegeben, in dem die These zurückgewiesen wird, dass Griechenland nicht darum herumkommen wird, den Gegenwartswert seiner Schulden durch eine Reduktion der Zinsen, eine Laufzeitverlängerung oder sogenannte haircuts zu vermindern. Das firmiert alles unter dem Begriff „default„, also Vertragsverletzung und Kreditausfall, zulasten der Gläubiger.
Es sieht nämlich so aus, als ob das staatliche Defizit von 13,6 Prozent des BIP im vergangenen Jahr auf 6 bis 7 Prozent in diesem Jahr sinkt, vor allem durch eine starke Reduzierung der Investitionsausgaben. Bei diesem Tempo kann die 3-Prozentmarke innerhalb kürzester Zeit erreicht werden. Rasche Erfolge sind in vielerlei Hinsicht besser als ein langgestreckter und daher ständig gefährdeter Konsolidierungsprozess. Aus Sicht der Allianz – die als Großgläubiger natürlich auch pro domo argumentiert – sind die Defizitprognosen der EU und des Internationalen Währungsfonds viel zu wenig ehrgeizig (Defizit im Jahr 2011: 7,6 Prozent des BIP). Der Ehrgeiz der Griechen sollte eher unterstützt als gebremst werden. Noch müssen sie für zehnjährige Staatsanleihen 7,83 Prozent zahlen, 5,18 Prozentpunkte mehr als die Bundesregierung. Es lohnt sich, diesen Abstand zu verringern. Irland, das sich vor ein paar Monaten in einer nicht weniger misslichen Lage befand wie Griechenland, hat den Zinsabstand zu Bundesanleihen durch seine entschlossenen Maßnahmen inzwischen auf 2,29 Prozentpunkte vermindert.
Der kleinen Tabelle mit Zahlen aus der EU-Datenbank (AMECO) ist zu entnehmen, dass die fiskalische Situation Belgiens 1995 deutlich schlechter war als die von Griechenland heute. Im Jahr 1995 machten die Zinszahlungen nicht weniger als 16,9 Prozent der belgischen Staatsausgaben aus, gegenüber den griechischen 10,0 Prozent vom vergangenen Jahr. Auch vom Schuldenstand her steht Griechenland besser da als Belgien damals. Wenn es Belgien in gerade einmal fünf Jahren gelungen ist, die fiskalische Situation nachhaltig zu verbessern, warum sollte das nicht auch Griechenland gelingen? Bisher sind die Fortschritte jedenfalls eindrucksvoll.
| Indikatoren der öffentlichen Verschuldung | ||||
| 1995 | 2000 | 2009 | 20101) | |
| Belgien | ||||
| Zinsen (in % des BIP) | 8,9 | 6,6 | 3,7 | 3,8 |
| Zinsen (in % der Staatsausgaben) | 16,9 | 13,4 | 6,8 | 7,0 |
| Verschuldung (in % des BIP) | 129,4 | 107,9 | 96,7 | 99,0 |
| Griechenland | ||||
| Zinsen (in % des BIP) | 11,2 | 7,3 | 5,1 | 5,4 |
| Zinsen (in % der Staatsausgaben) | 24,6 | 15,7 | 10,0 | 11,1 |
| Verschuldung (in % des BIP) | 97,0 | 103,4 | 115,1 | 124,9 |
| 1) Projektion Quelle: AMECO |
||||
Man zögert, auch anderen Ländern solche Rosskuren zu empfehlen, weil sie natürlich pro-zyklisch sind und daher die aktuelle Lage verschlimmern. In Estland, wo vorher de facto Vollbeschäftigung herrschte, ist die Arbeitslosenquote innerhalb kürzester Zeit auf 20 Prozent gestiegen, was aber von der Bevölkerung mit Gleichmut hingenommen wird. Das Ziel ist schließlich, in die Eurozone mit ihren dauerhaft niedrigen Realzinsen aufgenommen zu werden. Das dürfte gelingen.
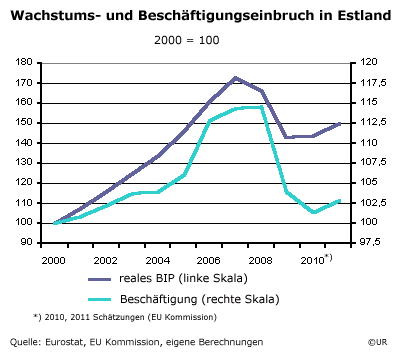
Insgesamt macht das aggregierte Sozialprodukt Griechenlands, Spaniens, Portugals und Irlands nur rund 18 Prozent des Sozialprodukts von Euroland aus. Das scheint mir eine beherrschbare Größenordnung zu sein was die Effekte auf die Konjunktur der Währungsunion insgesamt angeht. Die Strategie geht allerdings nicht auf, wenn die wirtschaftlichen Schwergewichte Deutschland, Frankreich, Italien und Holland sich ähnliche Kuren verschreiben würden. Es wäre verheerend, und der direkte Weg in die Depression, wenn es zu einem allgemeinen Wettbewerb um die härteste Restriktionspolitik käme. Für große Länder gelten andere Spielregeln.
Wenn die USA, Japan oder Deutschland mitten in der Krise, in einer Zeit, in der die Kapazitätsauslastung so niedrig und die Arbeitslosigkeit so hoch ist wie seit Jahrzehnten nicht mehr, auf Teufel komm raus sparen, kann es gefährlich werden. Vor allem wenn dann auch noch die Notenbanken, besorgt um ihren Ruf, mit ihren Exitstrategien ernst machen, Liquidität verknappen und die Zinsen erhöhen. Eine sogenannte double dip recession wäre dann ziemlich sicher, jedenfalls im OECD-Bereich, aber es könnte auch zu einer Abwärtsspirale mit neuer Deflation und jahrelanger Stagnation oder mehr kommen. Die gesamtwirtschaftliche Nachfrage darf von der Politik nur dann reduziert werden, wenn sicher ist, dass sich der Aufschwung selbst trägt. Dafür gibt es noch zu wenige Anzeichen. Die OECD in Paris empfiehlt derweil in ihrem neuen Economic Outlook, Strukturreformen voranzutreiben, die Haushalte zu sanieren und die monetären Exitstrategien vorzubereiten. Sie hat dabei, angebotsorientiert wie sie nach wie vor ist, nicht zuletzt die großen Länder im Visier.
Noch sind die Outputlücken gewaltig. Von daher sind die Rezessionen keineswegs eine Sache der Vergangenheit. Einige Zahlen dazu: in den USA betrug das Trendwachstum des realen BIP im vergangenen Zyklus (bis Q2 2008) 2,2 Prozent; im ersten Quartal 2010 lag das Sozialprodukt immer noch um 4,1 Prozent unter dem Trendwert. In Japan, wo das Produktionspotential mit jährlich 1,0 Prozent wächst, errechnet sich eine Lücke von 6,6 Prozent, und in Deutschland haben wir es mit 1,4 Prozent Trendwachstum und 7,8 Prozent Outputlücke zu tun.
Vor allem hierzulande sind wir also weiter denn je von einer Normalauslastung entfernt und in keinem anderen großen Land sind die Inflationsgefahren daher so gering. Ein sehr großes konjunkturelles Defizit wäre also hinnehmbar. Wie es aussieht, wird das tatsächliche Defizit 2010 aber nicht besonders stark zunehmen, weniger wegen der geplanten Sparbeschlüsse als wegen der besser als erwartet laufenden Konjunktur. Wenn ich mir die Frühindikatoren und die geradezu sensationell guten Zahlen vom Arbeitsmarkt anschaue, dürfte das reale BIP im Durchschnitt des Jahres zwischen 2 und 2 1/2 Prozent über dem Niveau von 2009 liegen, China sei Dank.
Deutschland wird sich wieder einmal durch den Außenhandel aus dem Sumpf ziehen und leider nicht die Konjunkturlokomotive für den Rest Europas spielen. Es könnte aber trotzdem zu einem happy end kommen. Nur darf es in den Schwellenländern keinen Crash der Aktienmärkte oder Immobilienmärkte geben. Wie wir inzwischen gelernt haben, kann sich durch den Zwang, Schulden abzubauen, die man für Häuser und Aktien aufgenommen hat, die auf einmal viel weniger wert sind, eine mehrjährige Stagnationsphase ergeben. Das wäre das Todesurteil für die europäische Konjunktur. Von einem Aufschwung, der von der Binnennachfrage getragen ist, kann nämlich noch lange nicht die Rede sein. Die Restriktionspolitik in den großen Ländern der Währungsunion ist daher ein Spiel mit dem Feuer.