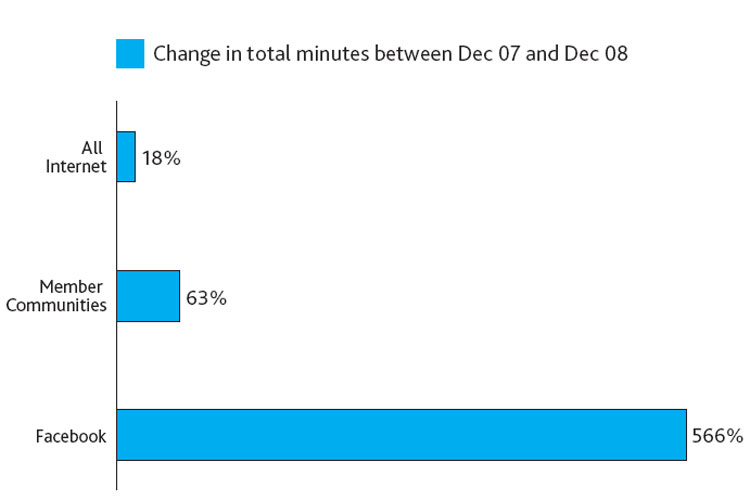Die Union diskutiert ihre steuerpolitische Ausrichtung. Während die Kanzlerin Steuersenkungen vorschlägt, um so die kriselnde Konjunktur zu beleben, warnen Parteifreunde vor solchen Schritten. So haben sich Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble und Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich zu Wort gemeldet und gemahnt, keine Wahlversprechen zu geben, die nach der Bundestagswahl nicht eingehalten werden können. Damit treffen sie den Nerv vieler Wähler, denn die Skepsis gegenüber Vorschlägen, die zu Wahlkampfzeiten geäußert wurden, ist traditionell groß.
Die Union diskutiert ihre steuerpolitische Ausrichtung. Während die Kanzlerin Steuersenkungen vorschlägt, um so die kriselnde Konjunktur zu beleben, warnen Parteifreunde vor solchen Schritten. So haben sich Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble und Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich zu Wort gemeldet und gemahnt, keine Wahlversprechen zu geben, die nach der Bundestagswahl nicht eingehalten werden können. Damit treffen sie den Nerv vieler Wähler, denn die Skepsis gegenüber Vorschlägen, die zu Wahlkampfzeiten geäußert wurden, ist traditionell groß.
Ist dieses Misstrauen berechtigt? Der sozialwissenschaftliche „Klassiker“ zur Frage der Übereinstimmung von Wahlprogramm und Regierungspolitik ist eine Studie von Hans-Dieter Klingemann, Richard Hoffebert und Ian Budge aus den 90er-Jahren, deren Erkenntnisse bis heute als wegweisend gelten. Die Forscher ermittelten (u.a. anhand der Ausgabenpolitik von Regierungen), dass die Politik besser ist, als ihr Ruf. Deutschland zählt demnach im internationalen Vergleich zu den Staaten, in denen politische Entscheidungen nach einer Wahl in hohem Maße auf den Wählerauftrag zurückzuführen sind: Die Wähler haben den siegreichen Parteien ein Mandat erteilt und diese setzen ihre Programme um (die so genannte „Mandats-These“). In anderen Ländern (etwa Frankreich oder Großbritannien) gilt hingegen tendenziell eher die „Agenda-These“: Es ist weniger wichtig, welche Partei einen bestimmten Vorschlag formuliert hat – nach einer Wahl setzt der Sieger die prominentesten Vorschläge um.
Natürlich wird auch in Deutschland nicht jedes Wahlversprechen erfüllt und kaum ein Koalitionsvertrag spiegelt die Wahlprogramme der beteiligten Parteien exakt wider. Der allgemeine Trend ist aber eindeutig: Parteien halten sich an Ihre Versprechen und versuchen, ihre politischen Forderungen nach der Wahl umzusetzen. Dass sich dennoch der Eindruck hält, dass Politiker ihre Wähler täuschen, ist nicht zuletzt der Logik des politischen Prozesses geschuldet: Konsense und reibungslose Kompromisse erfahren nicht die selbe Beachtung wie politische Streitigkeiten. Die Opposition wird sich auf diese Probleme beziehen, wenn sie die Regierung attackiert, und auch innerhalb der Koalition sind die Partner stets um Profilierung bemüht – die nächste Wahl kommt bestimmt…
Nichtsdestotrotz ist den Parteien bezüglich der Einhaltung ihrer Wahlversprechen ein gutes Zeugnis auszustellen. Die Wahlprogramme sind so formuliert, dass die Umsetzung, sprich: Finanzierung, möglich ist. Dies ist auch Resultat der innerparteilichen Demokratie, die einem Programmbeschluss voraus geht und unrealistische bzw. unseriöse Forderungen zumeist frühzeitig stoppt. Insofern können die Einwände aus der Union durchaus als konstruktive Beiträge verstanden werden. Für Ministerpräsident Tillich, dessen Regierung im Sommer selbst zur Wahl steht, ist dies zudem eine gute Möglichkeit, an Profil zu gewinnen und sich von den politischen Wettbewerbern in Sachsen abzuheben. Dass die Kritik am Wahlkampf auf diesem Wege selbst zu einer wirkungsvollen Wahlkampfaussage werden kann, ist eine weitere Besonderheit des politischen Prozesses.