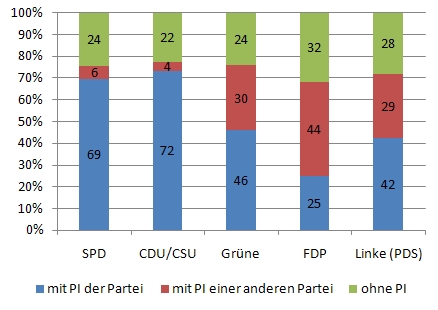Es ist ein beliebtes Spiel am Abend nahezu jeder Landtags-, Europa- oder Bundespräsidentenwahl. Journalisten fragen Experten – meist Politikwissenschaftler – danach, welche Auswirkungen dieses regionale Wahlergebnis auf die Bundesebene haben wird. Die Experten spielen häufig mit und mutmaßen darüber, dass diese unerwartet hohen Verluste, Gewinne oder diese neue Koalitionskonstellation schon in der ein oder anderen Weise die Bundespolitik beeinflussen werde.
Es ist ein beliebtes Spiel am Abend nahezu jeder Landtags-, Europa- oder Bundespräsidentenwahl. Journalisten fragen Experten – meist Politikwissenschaftler – danach, welche Auswirkungen dieses regionale Wahlergebnis auf die Bundesebene haben wird. Die Experten spielen häufig mit und mutmaßen darüber, dass diese unerwartet hohen Verluste, Gewinne oder diese neue Koalitionskonstellation schon in der ein oder anderen Weise die Bundespolitik beeinflussen werde.
Aus Sicht der Wissenschaft sollte man mindestens ein Fragezeichen hinter solche Medienspiele setzen. Zum einen können die Wähler sehr wohl zwischen verschiedenen Wahlebenen unterscheiden. Gute Indikatoren sind unterschiedliche Wahlbeteiligungsraten oder die ganz unterschiedliche Bewertung von Bundes- oder Landesregierungen sowie -parteien. Und am gleichen Tag gab es schon häufig in verschiedenen Bundesländern ganz unterschiedliche Wahlergebnisse wie z.B. am 25. März 2001 in Baden-Württemberg (hier gewann die CDU hinzu und blieb in der Regierung) und in Rheinland-Pfalz (hier gewann die SPD hinzu und blieb an der Regierung). In beiden Fällen spielte die Landespolitik für die Wahlentscheidung die zentrale Rolle.
Wir wissen andererseits, dass Wahlergebnisse niedrigerer Ordnung stets zu einem variablen Grad von der Bundespolitik beeinflusst werden. Vor allem inmitten von Legislaturperioden des Bundestags gibt es häufig starke anti-gouvernementale Effekte, die dann auch die Landesparteien zu spüren bekommen. Viele Wähler protestieren auf der ihnen gerade zur Verfügung stehenden (Landes-)Ebene gegen die Bundesregierung. Dies begünstigte vor fünf Jahren die CDU im Saarland, die PDS in Thüringen und die NPD in Sachsen. Nun stehen wir am Ende der Legislaturperiode auf Bundesebene, so dass diese Effekte deutlich schwächer sein werden. Zum anderen ist vor allem die CDU nicht mehr in der Opposition, sondern führende Regierungspartei. Insbesondere für sie wird es schwieriger als 2004, zumal im Saarland, wo der Regierungschef immerhin schon zehn Jahre im Amt ist.
Mögliche Effekte von Landtagswahlergebnissen auf Bundestagswahlergebnisse sind demgegenüber vor allem eines: hoch spekulativ. Nicht vier, sondern zwei Wochen vor der Bundestagswahl 1998 fand eine Landtagswahl in Bayern statt. Die CSU gewann damals – trotz hoffnungsloser Situation der Union auf Bundesebene – hinzu und verteidigte souverän die absolute Mehrheit in Bayern. Ein Bundeseffekt dieser Wahl blieb aus, zumindest zwei Wochen später. Es gab in Umfragen zwar einen temporär positiven Effekt für die CDU/CSU in der Woche unmittelbar nach der damaligen Bayernwahl, doch bis zur Bundestagswahl war dieser Effekt verflogen. Selbst die Bayern konnten Kohl nicht retten.
Wie also sollten die drei Landtagswahlen (oder gar die Kommunalwahlen in NRW) von heute Einflüsse auf das Wahlverhalten bei der Bundestagswahl am 27. September haben? Und wie sollten sie Steinmeier zurück „ins Rennen“ bringen? Sicher, systematisch ausschliessen kann man bundespolitische Effekte nicht, vor allem wenn es sich um dramatische Ergebnisse handelt. Doch wenn beispielsweise ein Ministerpräsident stürzt, hat das zwar politische Effekte, vor allem auf innerparteiliche Machtverhältnisse, aber das Wahlverhalten auf der weitaus wichtigeren politischen Ebene, dem Bund, wird davon weitgehend unbeeinflusst bleiben. Zwar entschlossen sich Schröder und Müntefering noch am Abend der verlorenen Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen im Mai 2005, vorgezogene Neuwahlen anzustreben. Doch die NRW-Wahl war lediglich der schmerzhafte Endpunkt einer langen Leidenszeit. Vorausgegangen waren Landtagswahlpleiten in Serie, ein „Heide-Mörder“ und eine Abspaltung von der SPD, die WASG. Die Lage ist 2009 eine völlig andere. Deshalb werden die Wahlen von heute vor allem eines sein: Der Startschuss für den Endspurt des Bundestagswahlkampfs 2009. Hier geht es dann um eine neue Bundesregierung. Die landespolitischen Ergebnisse von heute werden, davon sollte man ausgehen, für die Wähler dann keine Rolle mehr spielen.