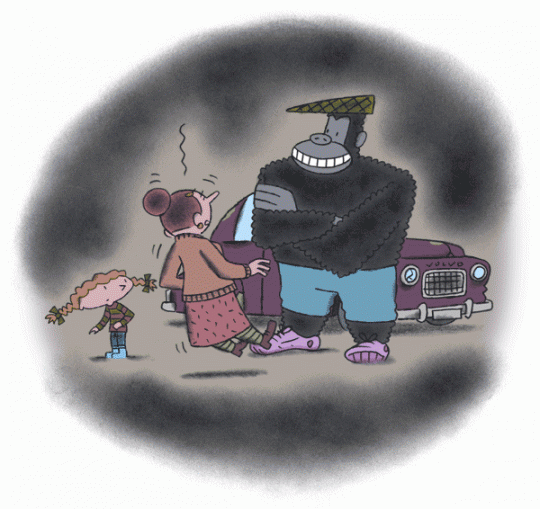
Von Frida Nilsson
Das Waisenmädchen Jonna lebt zusammen mit 50 anderen Kindern in einem Heim, unter der strengen Aufsicht von Leiterin Gerd. Die Kinder sehnen sich nach einem echten Zuhause mit lieben Eltern, und als Besuch ins Haus steht, der sich ein Kind aussuchen will, können sie es kaum erwarten. Bis sie sehen, wer da kommt…
Als ich neun Jahre alt war, wurde ich von einem Gorilla adoptiert. Ich hatte niemanden darum gebeten, aber passiert ist es trotzdem. Es war an einem Tag im September. Alle Kinder aus dem Rainfarn – einem Heim für elternlose Kinder – waren in den Garten gescheucht worden, denn es war Großputztag. Der Wind tanzte herum und wirbelte die zusammengeharkten Laubhaufen immer wieder durcheinander. Gerd, die Heimleiterin, hatte angeordnet, dass alle Laken, Handtücher, Kissen und Decken zum Lüften und Ausschütteln mit nach draußen genommen werden sollten. Sie selbst patrouillierte zwischen uns auf und ab und kontrollierte alles, während sie gleichzeitig penibel darauf achtete, nur ja nicht in die Nähe der Staubwolken zu kommen. »Denkt daran, das nächste erst auszuschütteln, wenn der Staub sich gelegt hat!«, rief sie. »Sonst bekommt ihr Kehlröcheln, und ich habe das Elend dann am Hals.« Aron und ich hielten je ein Ende des Betttuchs in der Hand. »Pass doch auf!«, sagte ich. »Du schüttelst zu fest.« Aron schüttelte noch fester. »Ich kann nichts dafür, dass ich so stark bin«, sagte er und legte los, dass sein Gesicht blaurot anlief. Meine blonden Zöpfe hüpften mir um den Kopf herum. Im Rainfarn mussten alle Mädchen mit langen Haaren Zöpfe tragen. Auf diese Weise könnten die Läuse nicht so leicht einziehen und es sich gemütlich machen, behauptete Gerd. »Hör auf!«, brüllte ich und riss Aron das Betttuch aus der Hand. Er fuhr sich über die Nase und zog eine Schnodderblase hoch. Sein Gesicht war übersät mit Sommersprossen. »Dann schüttele doch allein«, sagte er, hob ein Kissen vom Boden auf und schlug es gegen seine Knie, als wollte er es umbringen. »Beeilt euch, dann seid ihr schneller fertig!«, nörgelte Gerd. Sie trug ihren hellgrünen Putzkittel, und an ihren Ohren glitzerten kleine goldene Ohrhänger.
Niemand beeilte sich. Früher fertig zu werden bedeutete schließlich, dass wir auch früher damit anfangen mussten, den Boden im Haus zu scheuern. Oder Fenster zu putzen, Kartoffeln zu schälen, abzuwaschen und das Laub auf dem Rasen zusammenzuharken. An Spielen war nicht zu denken. Gerd war der Ansicht, dass wir schon ausreichend Freizeit hatten, immerhin schliefen wir nachts. Aber das Großreinemachen stand nicht grundlos an. Das Kinderheim erwartete Besuch. Jemanden, der sich ein Kind aussuchen und es adoptieren wollte. Gerd war nervös, das war sie an solchen Tagen immer. Schon frühmorgens war sie wie ein aufgeregtes Huhn herumgerannt und hatte Haus und Kinder überprüft. Staubmäuse mussten gejagt, die Löcher in den Kleidern gestopft und alle Ohren sorgfältig geschrubbt werden.
»Gott sei Dank habt ihr wenigstens ordentlich geschnittene Haare«, murmelte sie und musterte uns. Jedes Kind hatte einen frisch frisierten Kopf, denn der Fotograf war gerade erst im Rainfarn gewesen und hatte ein Gruppenfoto von uns gemacht. Er kam jedes Jahr, und in der Woche vorher holte Gerd die große Küchenschere raus und schnitt uns allen die Haare. Für das Bild mussten wir uns vor dem Haus aufstellen und so hübsch lächeln, wie wir nur konnten. Das war immer lustig. Eine willkommene Abwechslung in dem ewigen Putzen. Aber das Besondere daran war, dass es diese Fotografiererei schon gab, seit das Rainfarn gebaut worden war. In der Eingangshalle hingen jede Menge Fotos, auf denen alle verewigt waren, die jemals im Kinderheim gelebt hatten. Und beinahe überall war Gerd mit drauf. Sie war schon als junge Frau Heimleiterin im Rainfarn gewesen.
»Schau einer an«, sagte sie und reckte den Hals. »Da kommt die Post.« Ich schielte zur Wegbiegung hinunter, wo ein schwarzes Auto mit goldenem Posthorn aufgetaucht war. Gerd hastete zum Zaun und fuchtelte mit den Armen wie ein Dirigent. -»Stoooopp!«, krähte sie dem Briefträger entgegen, der die Scheibe hinunterkurbelte. »Hier ist frisch geharkt!« Sie streckte ihre füllige Hand nach dem Kuvert aus, das der Postbote gerade in den Briefkasten stecken wollte. »Nur her damit.« Das Auto verschwand wieder, und leise summend riss Gerd den Brief auf. Aber als sie anfing zu lesen, blieb ihr das Liedchen im Hals stecken. »Die Stadtverwaltung kommt zur Inspektion«, murmelte sie und ließ unruhig ihren Blick über uns Kinder schweifen. Ungefähr so, als zählte sie, wie viele wir waren. Eigentlich hatte sie es nicht nötig, uns zu zählen. Es verging kein Tag, an dem Gerd uns nicht daran erinnerte, dass wir einundfünfzig Kinder waren und dass das genau eins mehr war als erlaubt. Das Rainfarn war ein Heim für fünfzig Kinder.
»Ha-ha!«, zischte Aron und wackelte mit den Augenbrauen. »Das war’s dann wohl für einen von uns.« Ich hörte auf, mein Laken zu schütteln, und wischte mir den Schweiß von der Stirn. »Hä?«, sagte ich. Aron riss die Augen auf, bis sie groß wie Spiegeleier waren. »Weißt du denn nicht, dass Gerd sich die, die sie nicht haben will, einfach vom Hals schafft?« – »Vom Hals schafft?«, flüsterte ich. Ich spürte ein ungutes Stechen in der Magengegend. »Abmurkst oder wie?« Er wiegte seinen Kopf vor und zurück. »Vielleicht nicht direkt«, sagte er. »Aber hast du noch nie davon gehört, was sie damals mit dem Kind gemacht hat, das ihr lästig geworden war?« Ich schüttelte den Kopf. Aron kam ein paar Schritte näher. »Ich habe gehört«, zischte er und schielte zu Gerd hinüber, »dass hier vor langer Zeit ein Kind war, das sie nicht leiden konnte. Und eines Nachts hat sie das Kind auf ihren Gepäckträger gesetzt und ist mit ihm davongefahren. Sie hat es in irgendeinem alten Schuppen abgesetzt. Zu essen gab es dort auch nichts, aber das Kind war noch so klein, dass es sich nicht wehren konnte. Gerd ist nach Hause gefahren und nie wieder dorthin zurückgekehrt. Also ist das Kind gestorben.« Ich starrte ihn an. Er nickte und zog seine Mundwinkel bis zu den Ohren hoch. »Pah!«, sagte ich. »Du lügst ja.« Aron zuckte mit den Schultern. »Vielleicht«, sagte er. »Aber vielleicht auch nicht. Mich kann sie jedenfalls nicht einfach wegschleppen, ich bin zu stark.« Geräuschvoll schleuderte er sein Kissen auf den Boden.
Gerd las noch immer in ihrem Brief. »Dienstag in zwei Wochen …«, murmelte sie. »Die Inspektoren kontrollieren die hygienischen Verhältnisse und zählen routinemäßig alle Kinder durch. Mit freundlichen Grüßen, Tord Fjordmark.« Sie schluckte und fing an, auf ihrer Unterlippe herumzukauen. Dann sah sie hoch und bemerkte, dass einige von uns noch immer dastanden und sie anstarrten. »Ja, ja!«, sagte sie mit gespielter Ruhe. »Da müssen wir wohl zusehen, dass bis dahin alles geputzt ist. Und ihr müsst eure Fingernägel sauber machen. Jonna!« Ich zuckte zusammen, als mein Name so unerwartet und streng fiel. Das verhieß selten etwas Gutes. Mit verärgerter Miene watschelte Gerd auf mich zu und baute sich vor mir auf. »Glaubst du wirklich, dass die Betttücher sauberer werden, wenn du mit deinen Dreckpfoten daran herumfingerst?!« Ich betrachtete meine Hände. Ich hatte schon wieder vergessen, sie zu waschen, und das Laken, das ich festhielt, war tatsächlich ziemlich schmutzig geworden. Gerd riss es mir aus der Hand. »Kein Wunder, dass hier alles so unappetitlich ist«, schimpfte sie und fuchtelte mit dem Bettbezug herum. »Am Ende bleibt ihr allesamt hier, bis ihr sechzig seid! Dann kann ich direkt in die Altenpflege wechseln!«
Offenbar wollte sie gerade nicht darüber nachdenken, dass sie selbst längst tot unter der Erde liegen würde, wenn wir Kinder sechzig waren. Jedenfalls erschauerte ich. Was für ein grässlicher Gedanke – für immer im Rainfarn zu bleiben. Gerd war eigentlich nicht gefährlich, nur eben keine richtige Mama. Man hatte eher den Eindruck, als wären wir Kinder ihr egal. Wenn einer Grippe hatte, bekam sie schlechte Laune, weil sie sich damit herumärgern musste. Wenn sich jemand das Knie aufschlug, galt ihre einzige Sorge den Teppichen, die nur ja keine Flecken bekommen durften. Eine richtige Mama hätte Mitleid mit ihrem Kind gehabt, aber Gerd tat nur sich selbst leid.
Sie wandte sich wieder an mich. »Du bist jetzt seit neun Jahren hier und hast noch immer nicht gelernt, dir die Hände zu waschen, bevor du etwas anfasst?« Ich spürte, wie meine Wangen brannten. Ein paar andere Kinder feixten, wie immer, wenn Gerd mit mir schimpfte, was ziemlich oft vorkam. Ich vergaß nämlich einfach immerzu, mich zu waschen. Dabei war es ja nicht so, dass ich gerne schmutzig war. Das Waschen verschwand nur irgendwie immer wieder aus meinem Kopf, ganz gleich, wie sehr Gerd auch schimpfte. Vielleicht war es ja so, dass mein Gehirn nicht dazu geschaffen war, an Seife zu denken. Vielleicht war es ja viel eher dazu geschaffen, an andere Dinge zu denken, aber dazu bekam es nie Gelegenheit, weil es sich immerzu gegen die Seifengedanken wehren musste, die Gerd ihm aufzwingen wollte.
Ab und zu kam mir tatsächlich der Gedanke, ob diese ganze Wascherei nicht auch ein bisschen unnötig war. So wie ich die Sache sah, konnte man jahrelang am Waschbecken stehen und sich abschrubben, aber wenn man dann endlich fertig war, war man kurz darauf schon wieder dreckig. Natürlich hätte ich mich nie getraut, Gerd so etwas zu sagen. Sie erklärte zu jeder Gelegenheit, dass es »Ironie des Schicksals« war, dass ausgerechnet sie ein Dreckschweinchen wie mich am Hals hatte. Nicht dass ich verstanden hätte, was sie mit »Ironie des Schicksals« meinte, aber sicher nichts Gutes. »Nun?«, sagte sie jetzt. »Bist du zu dumm, an eine so einfache Sache zu denken und dich zu waschen?« Ich schaute weg, ich wollte nicht antworten. Gerd legte gekünstelt die Hand hinter ihr Ohr. »Bist du ein bisschen dümmer als alle anderen, Jonna?« Jetzt starrten uns alle an. Ich biss mir auf die Lippen. »Nein«, flüsterte ich. »Wie bitte?«, rief Gerd, als wäre sie taub. »Wir können nicht hören, was du sagst. Antworte laut und deutlich. Bist du dumm?« – »Nein!« – »Aha. Dann geh und wasch dich.« Sie drehte sich um und hob die Stimme. »Wir anderen packen zusammen. Es nützt ja nichts, hier herumzustehen und den ganzen Tag zu schütteln, wenn ihr doch alles wieder dreckig macht.« Einige hatten sich gerade darangemacht, die Laken und Kissen zusammenzusammeln, um sie ins Haus zu bringen, als ein leises Brummen zwischen den Fichten herüberdrang.
Ein Auto. Wie eine Meute von Jagdhunden, denen Wildgeruch in die Nase stach, reckten alle Kinder die Hälse. »Immer mit der Ruhe jetzt!«, brüllte Gerd, aber niemand achtete auf sie. Jedes Auto, das zum Kinderheim kam, wurde gestürmt. Alle knufften und rammten sich gegenseitig die Ellenbogen in die Seite, um am weitesten nach vorne zu gelangen und endlich von hier wegzukommen. Oh, wie sehr wir uns alle sehnten! Nach einem richtigen Zuhause, nach einer richtigen Mama, nach so einer feinen, mit hochgesteckten Haaren, in einen Duft von Parfüm gehüllt. Nach einer Mama, die Mitleid bei Schürfwunden hatte, die »armer, kleiner Liebling« sagte, und nach einem Papa mit glänzenden Schuhen, der loseilte und Comic-Hefte kaufte, wenn man mit Grippe daniederlag. Weg aus dem Rainfarn wollten wir alle, und nachdem die Chance nicht größer war als eins zu einundfünfzig, war es nicht verwunderlich, dass wir bei den seltenen Gelegenheiten, in denen das Waisenhaus Besuch bekam, ziemlich drängelten.
Ich rannte mit den anderen an den Zaun. Und unten in der scharfen Kurve tauchte ein ramponierter alter Volvo zwischen den Fichten auf. Mit affenartiger Geschwindigkeit raste er vorwärts. Nur Sekunden später bog er in den Kiesweg ein. Er drehte rasant ein paar Runden um die große Eiche, kurvte noch ein paarmal mit der Schnauze nach rechts und nach links, als könne er sich nicht entscheiden, wo er parken sollte, und bremste schließlich abrupt ab und kam direkt vor uns zum Stehen.
Jetzt ähnelten nicht mehr nur Arons Augen zwei gebratenen Spiegeleiern. Dieses Auto sah aus, als wäre es gerade eben vom Schrottplatz getürmt. Sein Auspuff schleifte über den Boden, der Motor roch irgendwie verbrannt, und die Scheiben waren mit Aufklebern zugepflastert. Die Karosserie war vom Rost braun verkrustet, nur hie und da blitzten noch kleine Flecken des alten grünen Lacks hervor. Ich rümpfte die Nase. Wer auch immer da drinnen sitzen mag, es ist auf jeden Fall niemand, zu dem ich nach Hause ziehen will, dachte ich. Die anderen sahen aus, als dachten sie haargenau dasselbe. »Was für ein verrotteter alter Schrotthaufen!«, schrie Aron. »Lieber würde ich sterben, als mich da reinzusetzen!« Wie hypnotisiert war Gerd stehen geblieben und starrte ihren ruinierten Kiesweg an. Dann wanderte ihr Blick zu dem Auto. Die Fahrertür öffnete sich.
Ein kräftiges, schwarz behaartes Bein schwang sich heraus, der zugehörige Fuß steckte in einem völlig verdreckten Turnschuh mit zerschlissenen Schnürsenkeln. Da folgte schon das zweite Bein und es war genauso dick und struppig. Ich schluckte und reckte meinen Hals. Ein Teil von mir wollte stehen bleiben und sehen, wer aus diesem Auto stieg, aber gleichzeitig wollte ich nur noch weglaufen und mich verstecken. Es war irgendwie unheimlich, dass so ein Auto zum Rainfarn kam, es war ganz anders als sonst. Die Autos, die hierherkamen, waren immer schick. Jetzt griff eine Hand nach draußen, hielt sich am Autodach fest, und mühsam zwängte sich der Fahrer des Wagens mit Ächzen und Stöhnen durch die Tür. Ich war sicher, dass mein Herz für einige Sekunden aufgehört hatte zu schlagen. Totenstille machte sich breit.
Es war eine riesige Äffin! Gorilla. Zwei Meter groß, um den Bauch herum rund wie eine Tonne und der schwarze Kopf hatte die Form einer verwachsenen Birne. Sie hatte kein Oberteil an, aber ihre Beine steckten in einem Paar schäbiger blauer Leggins, die über den Knien Falten warfen. Gorilla bückte sich und zog an den Hosenbeinen, bis sie über den Schaft der Turnschuhe reichten. Dann verschränkte sie die Arme und musterte das Rainfarn: die Fensterreihen im ersten Stock, hinter denen sich der große Schlafsaal befand, den Erdkeller, in dem die Vorräte an Kartoffeln und Essiggurken lagerten, den Kücheneingang, den man benutzen musste, wenn man aus dem Gemüsegarten kam und dreckig war, und hinter all dem – den Waldrand, der sich wie eine schwarze Wand in den Himmel erhob. Eine ganze Weile stand sie da und sah sich das alles an, dann senkte sie den Blick und betrachtete höchst interessiert uns Kinder.
In rasendem Galopp flüchteten sich alle zum großen Haupteingang. Nur Gerd blieb stehen und starrte Gorilla an, als hätte sie ein Gespenst gesehen. Ich machte eine Kehrtwendung, um den anderen nachzulaufen. Jetzt hämmerte mein Herz in meinem Brustkorb, und die Stiefel knirschten auf dem Kies. Ich wollte rein, schnell! Aber da passierte etwas Seltsames: Ich blieb stehen. Es gibt keine Erklärung, warum. Ich blieb stehen, mit dem Rücken zu dieser hässlichen Gorilla, und ich erinnere mich, dass ich dachte: Ich sollte ins Haus rennen. Rennen und mich wie alle anderen verstecken. Aber ich konnte es nicht. Ich spürte auf meinem Rücken, wie sie mich ansah, so eindringlich und ausdauernd, dass ich gezwungen war zurückzugucken. Und obwohl ich es eigentlich nicht wollte, drehte ich mich langsam um. Gorillas braune Augen begegneten meinen. Sie lachte und zeigte ihre gewaltigen Hauer, die sich in abscheulichen Reihen aneinanderdrängten. Sie machte einen Schritt auf mich zu. Wie festgefroren stand ich da.
Da wurde Gerd ohnmächtig. Mit einem leisen Wimmern sank sie auf den Boden und blieb liegen. Gorilla beugte sich hinunter und begann, mit ihren großen Pranken über Gerds Gesicht hin und her zu wedeln. Gerd kam schnell wieder zu sich, und noch etwas wackelig auf den Beinen stand sie auf. Sie sah aus wie ein nervöser kleiner Buchfink. Da schoss ich wie der Blitz los und verschwand im Haus.
Im zweiten Teil unserer Sommergeschichte bangt Jonna um ihr Leben, weil sie von Gorilla adoptiert wird, die nicht nur
halsbrecherisch Auto fährt, sondern angeblich auch Kinder frisst.
Frida Nilsson:
Ich, Gorilla und der Affenstern
Gerstenberg
Verlag, 12,95 €
erscheint am
28. Juni 2010
