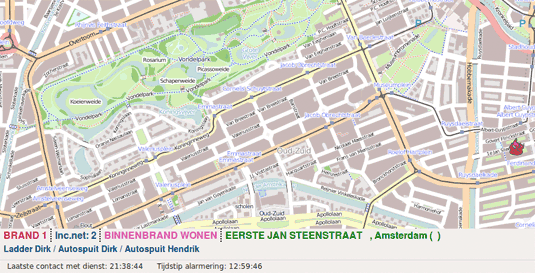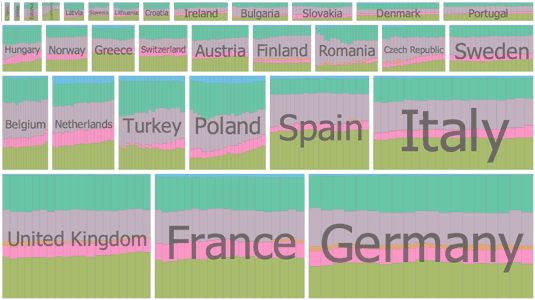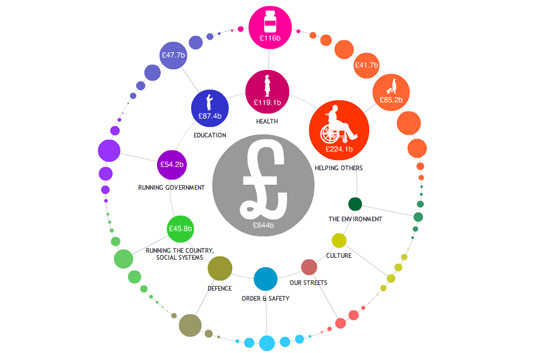Mercedes Bunz bezeichnet sich selbst als „Digital Thinker“. Die Journalistin arbeitete zuletzt beim Guardian in London als Technologieredakteurin. Ein Gespräch über die Rolle von Daten und Suchalgorithmen in unserer Gesellschaft.
Frau Bunz, im Herbst soll Ihr Buch über Algorithmen erscheinen. Worum wird es darin gehen?
Mercedes Bunz: Man sagt ja immer, dass die Digitalisierung so große Auswirkungen hat wie die Industrialisierung. Aber was heißt das? Ich glaube, wenn Industrialisierung und Automatisierung unsere Arbeitsabläufe verändert haben, dann verschieben Digitialisierung und Algorithmen, wie wir mit Wissen umgehen.
Mich interessiert vor allem, dass wir digitalisierten Menschen uns anders orientieren als früher. Dank Google beispielsweise ist eine neue Form von Wahrheit dazugekommen: Nicht mehr der wissenschaftliche Fakt, sondern die ’statistische Wahrheit‘ ist ausschlaggebend. Wenn ich nicht weiß, ob ‚Sauerstoffflasche‘ mit drei F geschrieben wird oder nicht, kann ich es googeln. Für das Ergebnis spielen Algorithmen eine essenzielle Rolle. Es ist nicht mehr nur der authentische Experte, der garantiert, dass etwas wahr ist, sondern eine Vielzahl von Quellen. Erst dank Algorithmen können wir uns über diese eine Übersicht verschaffen.
Was verstehen Sie unter Quelle?
Bunz: Zum Beispiel die Plattform Twitter. Sie ist bei einem Großereignis sehr nützlich. Aus journalistischer Perspektive wird Twitter häufig mit dem Argument angegriffen, es gäbe keine Quelle, man wüsste nicht, was echt ist. Das stimmt, doch dem kann man entgegnen, es ist wie bei einem Chor: Wenn einer falsch singt, ist die Melodie noch immer erkennbar. Twitter ist ein gewaltiger Chor an Stimmen und damit eine Quelle – die man, wie alle Quellen, mit Vorsicht genießen muss.