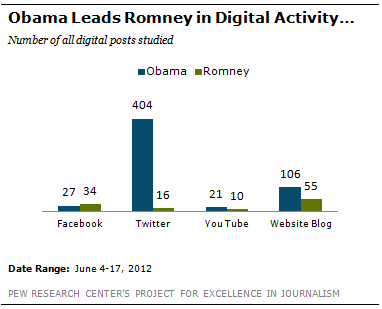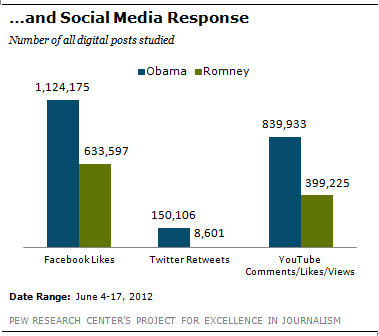Virtuelle Geschichte heißt ein Buch des renommierten britischen Historikers Niall Ferguson, der seiner Heimat und der Universität Oxford inzwischen den Rücken gekehrt hat. In den USA generell und an der Harvard-Universität fühlt er sich intellektuell ungleich wohler. In Virtuelle Geschichte spielt er mit Kollegen durch, wie die Welt aussähe, wären entscheidende historische Ereignisse nicht oder ganz anders eingetreten – etwa wenn Hitler den Zweiten Weltkrieg gewonnen hätte. Ein Fachbegriff dafür heißt auch kontrafaktische Geschichte, also Geschichte „entgegen den Tatsachen“.
Was das mit dem Wahlkampf in den USA zu tun hat? Abgesehen davon, dass die Beteiligten sich naturgemäß ebenfalls gern in dieser Disziplin versuchen? Ferguson gehört zu jenen Menschen, die mitunter offen Partei ergreifen für eine der beiden Seiten, in diesem Fall für die republikanische. Bei der vorigen Wahl war er Berater des Kandidaten John McCain. Er selbst hat sich einmal als „voll zahlendes Mitglied der neo-imperialistischen Bande“ bezeichnet. Nun durfte er in der Titelgeschichte des Magazins Newsweek ausführen, warum Barack Obama gehen muss und Amerika einen neuen Präsidenten braucht.
Zunächst einmal ist es legitim, wenn Ferguson fragt, ob Obama seine (ökonomischen) Versprechen eingehalten hat. Das tun viele, und nicht wenige sind enttäuscht. Doch mit seinem länglichen Stück „taucht Ferguson ab in eine Fantasiewelt nicht zutreffender und tendenziöser Fakten. Er versteht einfach alles falsch, wieder und wieder und wieder“ (Matthew O’Brien, The Atlantic). Die Kritik an seiner Argumentation ufert aus, es lässt sich kaum aufzählen, wie viele inhaltliche Fehler ihm politische Autoren und Schwergewichte des akademischen Betriebs vorwerfen. Selbst Fergusons Newsweek-Kollege Andrew Sullivan gelangt zu dem Schluss, das Stück sei dermaßen mit Fehlern, Auslassungen und Gedankensprüngen durchsetzt, dass er noch einige Beiträge brauchen werde, um sich mit allen zu beschäftigen.
„Fire his ass“
An der Spitze der Kritiker steht Paul Krugman, angesehener Ökonom, meinungsstarker bis egozentrisch-ätzender Kolumnist der New York Times und – der Vollständigkeit halber – nicht gerade freundlich den Republikanern gegenüber, aber im Grunde doch „ideologisch farbenblind“ (schrieb Michael Hirsch vor Jahren in Newsweek). Um Fergusons Artikel einen „unethischen Kommentar“ zu nennen, der eine Vielzahl von Fehlern und Entstellungen enthalte, unterbrach er sogar kurzerhand seinen Wanderurlaub (was Ferguson eher als Lob begreift). „Wir reden hier nicht über Ideologie oder auch nur ökonomische Analyse – es ist ganz simpel eine falsche Darstellungen der Fakten“, schreibt Krugman.
Fergusons Antwort auf Krugman hat wenig zur Auflösung der Vorwürfe beigetragen (Nachtrag: inzwischen hat er umfangreich nachgelegt), ist eher eine beleidigte Bekräftigung. Da liefern sich also zwei große Egos einen Schlagabtausch, könnte man meinen. Und sie tun es nicht das erste Mal; seit Jahren streiten diese beiden über Wege aus der US-Haushaltskrise. Doch längst zieht die Kritik weite Kreise und bringt den Historiker in Bedrängnis. James Fallows etwa schreibt bei The Atlantic unter der Überschrift „Als Harvard-Absolvent entschuldige ich mich„, Ferguson habe eine Geschichte geschrieben, die so nachlässig und wenig überzeugend sei, dass er sich frage, wie er sich überhaupt noch ein Urteil über die Arbeit seiner Studenten erlauben könne. Und der Ökonom J. Bradford DeLong (der sich als linken Neoliberalen bezeichnet), inzwischen an der University of California, Berkeley, früher unter anderem in Harvard, fordert sogar Fergusons Rausschmiss bei Newsweek („Fire his ass.„) und die Einsetzung eines Komitees in Harvard, das untersuchen solle, ob er moralisch noch geeignet sei, an einer Universität zu unterrichten.
Ferguson hat sich akademisch blamiert, das ist nur fair. Ärgerlich ist, dass ihm manch unbedarfter Leser dennoch glauben wird. Das eigentliche Problem der Republikaner ist ein anderes: John Cassidy (New Yorker) fragt sich zu Recht, wo in diesen Tagen die wirklichen Intellektuellen des konservativen Lagers abgeblieben sind. „Da müssen doch welche sein, aber manchmal scheint es so, als sei alles, was die Rechte zu bieten hat, ein Seifenkisten-Marktschreier wie (Vizepräsidenschaftskandidat) Ryan, ein Trio verbitterter Supreme-Court-Richter und ein paar knorrige Alte wie Bill Cristol, George Will und Charles Krauthammer, die in Washington zum Inventar gehören“, schreibt er. Nur angesichts dieses Vakuums sei es möglich, dass ein dynamischer und streitbarer „blow-in“ (Dahergelaufener, Zugereister) wie Ferguson als Obamas sichtbarster, wenn auch nicht überzeugendster Kritiker zutage treten könne.
Inzwischen hat Niall Ferguson ausführlich auf die Kritik geantwortet – Danke an @mrmoe_zfs für den Hinweis. Ich versuche, morgen noch einmal darauf einzugehen. (C.L.)
Nachtrag: Die umfangreiche Antwort Fergusons auf seine Kritiker hier im Detail noch einmal wiederzugeben, macht in meinen Augen wenig Sinn. Nur so viel: Einige der Punkte kann er nachvollziehbar abschwächen, über andere kann man weiter streiten. Darüber sollte sich jeder selbst ein Bild machen – mir ging es hier eher um die Darstellung der Debatte, in der ich selbstverständlich auch Position bezogen habe.