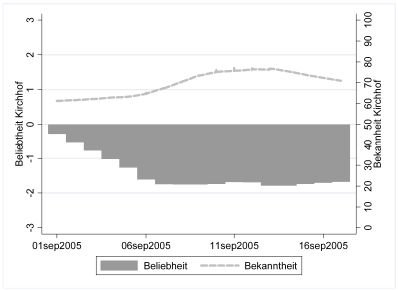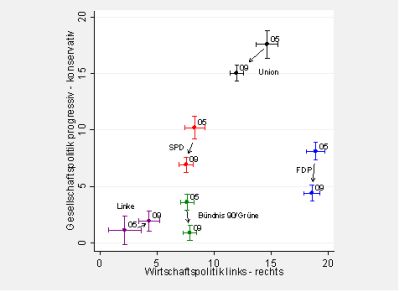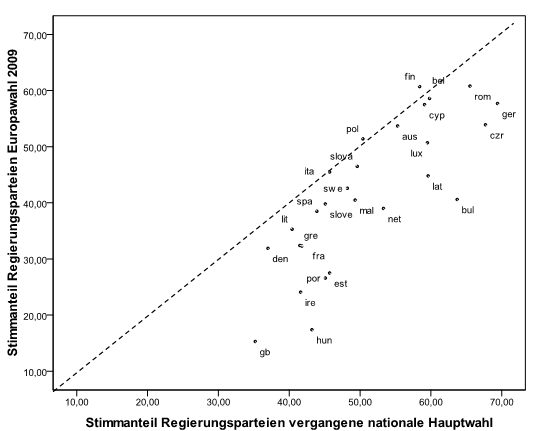Der Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan ist nicht sonderlich populär. Wie der jüngste ARD-Deutschlandtrend zeigt, stehen die Deutschen dem Bundeswehreinsatz in Afghanistan mehrheitlich kritisch gegenüber. Rund zwei Drittel der Befragten plädieren dafür, die Bundeswehr aus Afghanistan möglichst schnell abzuziehen. Auch das jüngste ZDF-Politbarometer weist eine, wenngleich weniger deutliche Mehrheit gegen den Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr aus. Diese Muster sind nicht neu. Bereits seit einiger Zeit sprechen sich in Bevölkerungsumfragen – je nach Institut und Frageformulierung – deutliche Mehrheiten oder bedeutende Minderheiten gegen die Fortsetzung des Afghanistan-Engagements aus. Folglich könnte eine Partei, der es gelingt, am 27. September die Gegner dieses Bundeswehreinsatzes auf ihre Seite zu bringen, mit erheblichen Stimmengewinnen rechnen. Gibt es realistische Chancen dafür?
Der Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan ist nicht sonderlich populär. Wie der jüngste ARD-Deutschlandtrend zeigt, stehen die Deutschen dem Bundeswehreinsatz in Afghanistan mehrheitlich kritisch gegenüber. Rund zwei Drittel der Befragten plädieren dafür, die Bundeswehr aus Afghanistan möglichst schnell abzuziehen. Auch das jüngste ZDF-Politbarometer weist eine, wenngleich weniger deutliche Mehrheit gegen den Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr aus. Diese Muster sind nicht neu. Bereits seit einiger Zeit sprechen sich in Bevölkerungsumfragen – je nach Institut und Frageformulierung – deutliche Mehrheiten oder bedeutende Minderheiten gegen die Fortsetzung des Afghanistan-Engagements aus. Folglich könnte eine Partei, der es gelingt, am 27. September die Gegner dieses Bundeswehreinsatzes auf ihre Seite zu bringen, mit erheblichen Stimmengewinnen rechnen. Gibt es realistische Chancen dafür?
Außenpolitische Themen haben es nicht leicht, das Wahlverhalten zu beeinflussen oder gar über den Wahlausgang zu entscheiden. Viele Bürger schenken der Außenpolitik häufig keine allzu große Aufmerksamkeit. Daher sind ihre Urteile über solche Fragen nicht sehr fundiert und recht leicht beeinflussbar. Aus diesem Grund ist bei der Interpretation entsprechender Umfrageergebnisse besondere Vorsicht geboten. Da viele Wahlberechtigte außenpolitischen Themen eine geringe Bedeutung beimessen, lassen sie solche Fragen nicht in ihre letztliche Stimmentscheidung einfließen. Innenpolitische Themen liegen für viele Bürger wesentlich näher. Daher gelten außenpolitische Fragen für die innenpolitische Meinungsbildung im allgemeinen und für Wahlverhalten im besonderen als nicht allzu bedeutsam.
Aber auch zu dieser Regel gibt es Ausnahmen. Man denke nur an die Bundestagswahl 2002. Im Sommer 2002 setzte Gerhard Schröder einen möglichen Krieg im Irak auf die innenpolitische Agenda. In den letzten Wochen vor der Wahl gewann das Thema merklich an Einfluss auf das Wahlverhalten und trug entscheidend dazu bei, dass die rot-grüne Bundesregierung nicht von einer schwarz-gelben Bundesregierung unter Edmund Stoiber abgelöst wurde. Schröder gelang es offenbar, den Bürgern die Wichtigkeit des Irak-Themas vor Augen zu führen und sie dabei auch emotional anzusprechen. Dass gerade letzteres nicht unwichtig ist, zeigen Analysen zum Irak-Krieg 1991. Denn damals sorgte vom Krieg ausgelöste Angst nicht nur dafür, dass die Bundesbürger die Regierungsparteien, die den US-geführten Militäreinsatz unterstützten, schlechter bewerteten. Vielmehr trug Angst sogar dazu bei, dass Bürger langfristige Parteiloyalitäten in Frage stellten. Die innenpolitische Meinungsbildung kann also durchaus erheblich auf die Außenpolitik reagieren.
Ob das im Falle des Afghanistan-Einsatzes gelingen wird, ist damit noch nicht gesagt. Zwar wirbt die Linke seit langem als entschiedene Gegnerin des Bundeswehreinsatzes um Stimmen. Doch scheint sie damit nicht durchzudringen. Das mag zum einen daran liegen, dass das Thema wenige Menschen anspricht. Zum anderen mag eine Rolle spielen, dass ein Votum für die Linke aus anderen Gründen für etliche Bürger kaum in Frage kommt. Würden andere Parteien eine einsatzkritische Position vertreten, stiegen die Chancen für Einflüsse der Afghanistan-Frage auf die Wahlentscheidung. Erst recht würde eine Emotionalisierung des Themas dessen Durchschlagskraft an der Wahlurne erhöhen. Damit wäre etwa dann zu rechnen, wenn die Zahl gefallener Bundeswehrsoldaten dramatisch anstiege oder aber ernstzunehmende Anschlagsdrohungen gegen Deutschland gerichtet würden. So betrachtet, bleibt zu hoffen, dass die Afghanistan-Frage am 27. September wirkungslos bleibt – ausgeschlossen sind solche Effekte freilich nicht.
Literaturempfehlungen
Schoen, Harald, 2004: Der Kanzler, zwei Sommerthemen und ein Foto-Finish. Priming-Effekte bei der Bundestagswahl 2002, in: Frank Brettschneider/Jan van Deth/Edeltraud Roller (Hrsg.), Die Bundestagswahl 2002. Analysen der Wahlergebnisse und des Wahlkampfes, Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften, 23-50.
Schoen, Harald, 2006: Beeinflusst Angst politische Einstellungen? Eine Analyse der öffentlichen Meinung zum Golfkrieg 1991, in: Politische Vierteljahresschrift 47, 441-464.