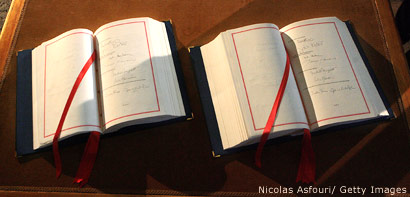Teil III des Lissabon Watch
Was könnte sich mit dem Lissabon-Vertrag schon bei der nächste Fußballeuropameisterschaft ändern? Oder bei den Olympischen Spielen – sollten sie irgendwann einmal wieder in einem EU-Land stattfinden? Oder beim nächsten G8-Gipfel?
Vielleicht kommt ja die Regierung im Gastgeberland dankbar auf einen Dreh, den der neue EU-Vertrag eröffnet. Nämlich Polizisten aus dem Ausland, und zwar nicht nur aus dem unmittelbaren Nachbarland, im Inland einzusetzen. Gemäß dieser Möglichkeit aus dem Lissabon-Vertrag:
Der Rat legt gemäß einem besonderen Gesetzgebungsverfahren fest, unter welchen Bedingungen und innerhalb welcher Grenzen die in den Artikeln 82 und 87 genannten zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten im Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaats in Verbindung und in Absprache mit dessen Behörden tätig werden dürfen. Der Rat beschließt einstimmig nach Anhörung des Europäischen Parlaments.
(Artikel 89 AEUV)
Rumänische Polizisten in Deutschland? Italienische Carabinieri beim Oktoberfest? Das sind spannende Vorstellungen. Vor allem aber sind sie mit der Rechtsstaatsgarantie des Grundgesetzes unvereinbar. Ausländische Polizisten sind schließlich nicht im deutschen Polizeirecht ausgebildet. Das ist aber eine ebenso selbstverständliche wie unverzichtbare Bedingung, um mit Exekutivgewalt deutschen Bürgern in ihrem Heimatland gegenüberzutreten.
Polizeirecht ist nicht mit Miet-, Kauf- oder Reiserecht vergleichbar. Es enthalt zusammen mit dem Strafrecht die tiefsten Eingriffsbefugnisse in Bürgerrechte, die dem Staat erlaubt sind. Die Voraussetzungen und Grenzen dieser Eingriffe selbst zu definieren, gehört zu den vornehmsten Rechten des demokratischen Souveräns.
Weiß jemand, unter welchen Bedingungen in Italien eine Demonstration aufgelöst werden kann? Wann in Rumänien Tränengas und Gummigeschosse eingesetzt werden dürfen? Wie in Frankreich der finale Rettungsschuss geregelt ist? Ob man in Spanien ein paar Gramm Haschisch dabei haben darf? Nein? Genauso wenig werden die ausländischen Beamten die deutsche Rechtslage kennen, zumal sie noch von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich ausgestaltet ist. Manch einer, der im Ausland schon einmal mit Polizisten zu tun hatte, weiß was er an den gründlich geschulten Beamten in Deutschland hat.
Natürlich, lässt sich einwenden, ist es nicht sehr wahrscheinlich, dass sich im Europäischen Rat (der Versammlung der EU-Regierungschefs) eine einstimmige Mehrheit für einen Polizeiaustausch findet. Aber das muss auch gar nicht geschehen. Es reicht laut Lissabon-Vertrag aus, wenn sich ein Drittel aller Staaten über solche Austauschprogramme einig werden, also neun. Diese können dann beschließen, bei der „operativen Polizeizusammenarbeit“ eine „verstärkte Zusammenarbeit“ (im Sinne des Artikel 20 EUV) einzugehen. In diesem Fall entfällt auch die Zustimmungspflicht des Europäischen Parlaments.
Unter denselben Voraussetzungen kann der Rat zudem eine „Europäische Staatsanwaltschaft“ einsetzen. Mit anderen Worten: Findet sich eine Koalition aus einem Drittel der EU-Staaten, können diese ihre Polizeien und Strafverfolgungsbehörden verschmelzen.
Dies ist eine Konsequenz aus Wunsch der EU-Regierungschefs, die Justiz- und Innenpolitik weitgehend zu harmonisieren. Auf den ersten Blick entsprechen sich damit den Erwartungen vieler Bürger an die Europäische Union. 81 Prozent der Europäer möchten, dass sich die EU stärker der Terrorismusbekämpfung annimmt, 60 Prozent finden, sie könne bei der Verbrechensbekämpfung mehr tun. So steht es nun auch im neuen Vertrag. Die entsprechende Ermächtigungsnorm lautet:
Die Union wirkt darauf hin, durch Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung von Kriminalität sowie von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit, zur Koordinierung und Zusammenarbeit von Polizeibehörden und Organen der Strafrechtspflege und den anderen zuständigen Behörden sowie durch die gegenseitige Anerkennung strafrechtlicher Entscheidungen und erforderlichenfalls durch die Angleichung der strafrechtlichen Rechtsvorschriften ein hohes Maß an Sicherheit zu gewährleisten.
(Art. 67 Abs. 3 AEUV)
Statt durch Rahmenbeschlüsse (= gesetzgeberische Anregung an die Einzelstaaten) kann die EU auf diesem Feld künftig durch Verordnungen (= unmittelbar geltendes Recht) und Richtlinien (= Beschlüsse, die von den Mitgliedsstaaten in nationales Recht umgesetzt werden müssen) aktiv werden. Für die Zusammenarbeit in der Justiz und Innenpolitik wird die Mehrheitsentscheidung im Rat zur Regel („ordentliches Gesetzgebungsverfahren“). Dies bedeutet, dass einzelne Staaten künftig bei sensiblen Rechtssachverhalten überstimmt werden können. Zwar muss das Europäische Parlament zustimmen, bevor solche Gesetze in Kraft treten. Doch das Parlament agiert nicht als Interessenvertreter einzelner Länder. Selbst wenn alle 99 deutschen Parlamentarier gegen einen Vorschlag des Rats stimmen sollten – es blieben noch fast 700 Abgeordnete, von denen sie überstimmt werden könnten. Für kleinere Länder sieht es noch schlechter aus.
In einer Analyse des Lissabon-Vertrages kommt die Berliner Stiftung für Wissenschaft und Politik (SWP) zu dem Ergebnis, mit diesen Regelungen werde die „schrittweise Supranationalisierung der europäischen Justiz- und Innenpolitik“ fortgeführt.
Das ist natürlich einerseits gut für Wirtschaft und Handel. Andererseits soll die Anerkennung von Urteilen nicht auf das Zivilrecht beschränkt bleiben, sondern auch auf das Strafrecht ausgedehnt werden. Und das ist schlecht für die Rechtssicherheit in Europa. Oder möchten wir wirklich, dass jedes in Italien, Bulgarien oder Rumänien erwirktes Strafurteil in Deutschland anerkannt wird? In allen drei Ländern erweisen sich Richter und Staatsanwälte bis heute als käuflich.
Falls der Lissabon-Vertrag, der ehemalige „Europäische Verfassung“ am 1. Januar 2009 in Kraft tritt, wird sich immerhin eines ändern: Die Ratssitzungen der Minister werden öffentlich. Überrollt werden von innovativer Rechtspolitik kann die Öffentlichkeit freilich dann auch weiterhin.
“Der Kommission fehlt einfach ein Überblick über die unterschiedlichen Rechtslagen in den 27 Mitgliedsländern”, sagt ein Experte für europäische Justizangelegenheiten in Brüssel. „Die übersehen dann schon mal Besonderheiten, die hier und dort herrschen.“
Natürlich kann die Bundesregierung solche Ideen aufhalten – Deutschlands Stimme hat im Rat schließlich Gewicht. Doch eine Intervention setzt voraus, dass die Bundesregierung auch mitbekommt, was sich in Brüssel anbahnt. Und dass sie es aufhalten möchte.
Bei europäischen Harmonisierungen der Rechtspolitik sieht der Lissabon-Vertrag zwar eine „Notbremse“ vor. Im Original heißt es:
Ist ein Mitglied des Rates der Auffassung, dass ein Entwurf einer Richtlinie nach Absatz 2 grundlegende Aspekte seiner Strafrechtsordnung beruhren wurde, so kann es beantragen, dass der
Europaische Rat befasst wird. In diesem Fall wird das ordentliche Gesetzgebungsverfahren ausgesetzt.
(Art. 82 Abs.3 AEUV)
Doch was genau sind „grundlegende Aspekte seiner Strafrechtsordnung“? Dies zu interpretieren, wäre eigentlich Sache der nationalen Parlamente. In Europa bleibt es den Fachministern im Rat vorbehalten – doch sind aller Erfahrung nach eher von Effizienzgedanken getrieben. Zudem, die Folge einer „Notbremsung“ in Brüssel bestünde lediglich darin, dass das Gesetzgebungsverfahren für höchstens vier Monate ausgesetzt würde.
Unklar ist auch noch, welche Rechtsschutzmöglichkeiten die EU dem Bürger parallel zu ihren wachsenden Kompetenzen, etwa bei der Terrorismusbekämpfung, einräumt. „Diese Frage wird in der Tat noch nicht richtig debattiert“, sagt Sarah Seeger vom Münchner CAP. „Ein Versuch, Schutz zu bieten, ist die Einrichtung eines europäischen Datenschutzbeauftragten. Aber hier gibt es aber Probleme – die parlamentarische Kontrolle muss weiter gestärkt werden.“
Weit auseinander gehen auch die Vorstellungen in den einzelnen Staaten darüber, welches Verhalten überhaupt strafbar sein soll. Der EU-Rahmenbeschluss zur Terrorismusbekämpfung aus dem Jahr 2002 zum Beispiel sieht vor, auch so genannte „Aufforderungstaten“ unter Strafe zu stellen, also etwa die Billigung und Aufforderung zu Straftaten. Darunter sollen nach jüngsten Vorschlägen der slowenischen Ratspräsidentschaft auch “bestimmte Formen rassistischer Meinungsäußerungen und Fremdenfeindlichkeit“ gehören.
Derart normative Begriffe ins Strafrecht aufzunehmen, ist gefährlich. Denn nicht alles, was als Meinungsäußerung abstoßend ist, darf auch bestraft werden. Was ist rassistisch? Was ist fremdenfeindlich?Was ist einfach nur eine primitive Haltung? Das Strafrecht ist dazu da, Rechtsgüter zu schützen; die Würde und Unversehrtheit von Menschen, zum Beispiel. Es ist aber nicht dazu da, xenophobe Menschen für ihre Beschränkheit zu bestrafen. Das war bisher in Deutschland nicht so, und auch Großbritannien hielt die Meinungsfreiheit auch der Dummen für schwer einschränkbar. Künftig aber könnte aus Brüssel eine Anweisung an alle Mitgliedsstaaten ergehen, diese Einstellung zu ändern – durch einen, wie gesagt, Mehrheitsbeschluss im Rat.
Mit dem Vertrag von Lissabon erhält die EU desweiteren die Möglichkeit, über die Ausgestaltung von Pässen und Personalausweisen zu bestimmen. Dazu sind allerdings weiterhin ein einstimmiger Ratsbeschluss sowie eine Anhörung des Europäischen Parlaments erforderlich.
Erscheint zur Erleichterung der Ausübung des in Artikel 20 Absatz 2 Buchstabe a genannten Rechts ein Tätigwerden der Union erforderlich, so kann der Rat gemäß einem besonderen Gesetzgebungsverfahren Bestimmungen betreffend Pässe, Personalausweise, Aufenthaltstitel oder diesen gleichgestellte Dokumente erlassen, sofern die Verträge hierfür anderweitig keine Befugnisse vorsehen.
(Art. 77 Abs. 3 AEUV)
Das freilich ist eine fragwürdige Kompetenzzuordnung. Schließlich benötigt man innerhalb der EU doch gar keine Reisepässe mehr. Welchem Integrationsziel soll es also dienen, wenn die EU eine Zuständigkeit für das Passwesen reklamiert? Für einen Mitgliedsstaat, in dem es keine Personalausweise, sondern nur Pässe gibt, ergäbe das Sinn. Doch Großbritannien, auf den das zutrifft, ist ohnehin nicht Teil des Schengenraums.
„Bei der Justiz- und Innenpolitik zeigt sich eine ungeheure Integrationsdynamik“, sagt die EU-Expertin Sarah Seeger vom Münchner CAP. „Diese kann durchaus im Spannungsverhältnis zum Subsidiaritätsgedanken stehen.“
Bliebe als juristischer Watchdog der Europäische Gerichtshof (EUGH). Er überprüft bei Klagen unter anderem die Übereinstimmung von EU-Rechtsakten mit der Europäischen Grundrechtscharta. Ob er allerdings zu einer ähnlich vorbildlichen Interpretation der Grundrechte wie deutsche Bundesverfassungsgericht, muss er erst noch beweisen.
Von der EU sollte man im Bereich Inneres und Justiz eine Politik des höchsten Standards erwarten. Genau dies aber wird durch den Lissabon-Vertrag unwahrscheinlicher. Denn je gemeinsamer die Nenner werden, desto kleiner werden sie auch.