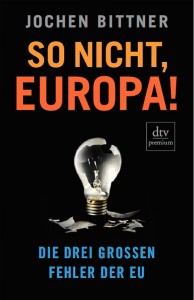Wie die Europäische Union auf die Revolutionen vor ihrer Haustür antwortet
Ein Protokoll
Nein, Brüssel ist doch kein Raumschiff. Es ist ein gewaltiger Tanker mit einem 27-Zylinder-Dieselmotor. Bis das sperrige Aggregat anspringt und den Pott in Fahrt bringt, dauert es eine Weile. So richtig auf Touren gekommen, kann er aber durchaus einen klugen Kurs ziehen. Das jedenfalls ist die bisherige Bilanz für den außenpolitischen Ernstfall Ägypten.
Bis zum vergangenen Freitag hat die Europäische Union noch geglaubt, sie könne die Revolutionen in Arabien im diplomatischen Gremienlauf verwalten. „Es gibt keine strukturierte Gesprächsvorbereitung über Ägypten“, antwortete ein Diplomat auf die Frage, wie Europa mit dem Wandel vor seiner Haustür umzugehen gedenke. Nicht? Nein, sagt der Mann, da sei nichts weiter. „Niemand hat bisher eine Generaldebatte über das Mittelmeer eingefordert.“ In Kairo riefen zu diesem Zeitpunkt Tausende Demonstranten „Mubarak: go go go!“, zogen Panzer auf, verhängte das Regime eine Ausgangssperre und drehte das Internet ab.
Eine SMS bringt die Maschinerie in Gang
Drei Tage später, auf dem Höhepunkt der ägyptischen Zeitenwende, sollten die Außenminister der EU in Brüssel zusammenkommen. Um kurz nach 16 Uhr am Freitag springt die außenpolitische Maschine an. In der Ständigen Vertretung Deutschlands bei der EU piepst das Handy von Hans-Dieter Lucas. Lucas ist der deutsche Botschafter im Politischen und Sicherheitspolitischen Komitee (PSK), dem Gremium, das die Außenministertreffen in Brüssel vorbereitet. Zweimal pro Woche treffen sich die 27 Gesandten der EU-Länder, um das Weltgeschehen in ministergerechte Häppchen zu zerlegen. Die SMS teilt mit: Die EU-Außenbeauftragten Catherine Ashton wünsche Ägypten auf die Agenda für das Außenministertreffen zu setzen. Europa müsse sich positionieren.
Das Wochenende über feilen Lucas und seine Kollegen in Berlin und Kairo an einem „Non-Paper“, einem internen Leitfaden, mit dem Guido Westerwelle in Brüssel ins Rennen gehen soll. Auf dem zweiseitigen Dokument wagen sich die Deutschen weit vor. „Die EU sollte erwägen, eine Wiederholung der Parlamentswahlen von 2010 zu unterstützen“, lautet ein Kernsatz. Im Klartext: Die Ägypter sollen so schnell wie Möglichkeit die Gelegenheit bekommen, Mubarak aus dem Amt zu fegen.
Am Montagvormittag geht es hektisch zu im 5. Stock des Justus-Lipsius-Gebäudes, dem gewaltigen Brüsseler Granitkubus, in dem sich die Staatenvertreter versammeln. In den Delegationsbüros versuchen die Diplomaten sämtlicher EU-Länder in aller Eile Schlussfolgerungen für die Minister vorzubereiten, ein Blatt Papier, auf das sich alle einigen können. Ab 14 Uhr wollen die Chefs über Ägypten reden. Aber wo sollen so schnell konsensfähige Formulierungen herkommen? Die unangenehme Frage, die plötzlich und ohne Generaldebatte gelöst werden muss, lautet, wie Europa seine Werte verteidigen kann, ohne sogleich seinen langjährigen Partner Hosni Mubarak fallen zu lassen.
„Die politische Uhr tickt“
Im abgeschirmten Sitzungssaal des Ratsgebäudes entspinnt sich eine lebhafte Diskussion. An der Seite Deutschlands, steht, grob gesprochen, das nördliche EU-Lager. Die arabische Welt stehe an einer „Wegscheide“, sagt der schwedische Außenminister Carl Bildt. „Die biologische und politische Uhr tickt. Die Ära Mubarak ist vorbei.“ Europa müsse sich schnell und klar engagieren, immerhin sei das 80-Millionen-Land Ägypten nach Russland Europas größter Nachbar.
Die südlichen EU-Länder raten eher zur Vorsicht. Die Gefahr einer islamistischen Machtübernahme sei nicht auszuschließen, mahnt der zypriotische Minister, „wir sollten vorsichtig sein, was wir uns wünschen.“
Die griechische Vize-Außenministerin äußert die Sorge, eine neue Flüchtlingswelle könne auf Europa zurollen. William Hague, der Brite, findet, die EU solle nicht „den Wechsel um den Wechsel Willen“ unterstützen. „Es handelt sich um eine große Chance, aber auch um ein großes Risiko.“
Die dänische Außenministerin Lene Espersen kontert, sie sei „verstört über diese Diskussion“. Europa dürfe doch Stabilität nicht mit Demokratie aufrechnen! Die Minister reden gut zwei Stunden, fast jeder möchte zu Wort kommen. Lady Ashton macht sich Notizen, sie muss aus all dem die eine EU-Position destillieren.
Aus dem Magma des Chaos…
Ein paar Meter vom deutschen Delegationsbüro entfernt hängt ein leuchtender Schriftzug an der Flurwand, designt von einem belgischen Künstler. „Order emerges again and again from the magma of chaos“, wieder und wieder wächst Ordnung aus der Magma des Chaos. Es ist, in treffend poetischen Worten, das Funktionsprinzip der EU. Bloß blubbert ausgerechnet jetzt, in einem definierenden Moment für die Peripherie der Staatengemeinschaft, das Brüsseler Chaos so gewaltig wie nie zuvor.
Die Revolutionen in Arabien erwischen eine EU in der Inventur. Die bisherige außenpolitischen Doppelstruktur – Strategiefindung im Rat, Verwaltung und Vertretung durch die Kommission – ist aufgelöst, die neue starke Säule, Ashtons Europäischer Auswärtiger Dienst (EAD), noch nicht funktionsfähig.
Zum 1. Januar wurden 1.643 außenpolitische Beamte aus Kommission und Rat auf neu geschaffene EAD-Stellen versetzt, mit neuen Titeln und E-Mail-Adressen versehen und neuen Kollegen zugewiesen. Political animals aus Regierungsgehegen treffen dieser Tage in vielen Büros ungebremst auf Budgetverwalter und Vertragstechniker des EU-Stadls. „Es herrscht eine gewaltige Unruhe im Apparat“, sagt einer von ihnen verzweifelt. Der wichtige Posten für Strategische Planung beispielsweise ist noch immer nicht besetzt.
Ashtons Mann in Kairo, der Belgier Marc Franco, sorgte derweil bei liberalen arabischen Bloggern für ungläubiges Staunen, als er im Dezember in einem Beitrag für die Zeitung Al-Ahram schrieb: „Man muss sagen, Ägypten hat in den vergangenen Jahren mutige Schritte unternommen, um eine Kultur der Menschenrechte auf allen Ebenen der Gesellschaft zu fördern.“ Das war wenige Tage nachdem Mubaraks NDP bei den Parlamentswahlen aufgrund von Einschüchterungen und Boykotts der Opposition eine beispiellose Mehrheit an sich gerissen hatte.
Zu allem Überfluss trat vergangene Woche auch noch der Generalsekretär der Mittelmeerunion zurück, jener Prestige-Plattform, mit dem die EU zu einer runderneuerten Zusammenarbeit mit Nordafrika finden wollte. Der Mann, ein Jordanier, sei frustriert gewesen von der EU, heißt es – und die EU von ihm. „So richtig unzufrieden mit seinem Rücktritt ist niemand“, sagt ein Insider in Brüssel. Diplomatisch steht die EU gerupft da.
Schweigen im Europaparlament
Kraft- und mutlos präsentiert sich auch das Europäische Parlament. Zwar versteht sich die Völkerversammlung, befeuert durch die neuen Kompetenzen des Lissabon-Vertrages, immer mehr als Antreiber der Mitgliedsstaaten. Doch eigene Ideen einspeisen in die erlauchte Runde der EU-Außenminister, das wollte es dann lieber doch nicht. Das Europaparlament, befindet selbstkritisch der liberale Abgeordnete Alexander Graf Lambsdorff, arbeite außenpolitisch noch genauso schwachbrüstig wie die EU insgesamt. Das Bild, dass Europa nach außen abgebe, erinnere ihn das unfertige Gebiss seiner Kinder: „Die Milchzähne sind schon raus, aber die Erwachsenenzähne noch nicht drin. Und überall klaffen Lücken.“
Und doch, es reckt sich, dieses Europa. Am Montagabend veröffentlichen die Außenminister die Schlussfolgerungen ihres Treffens. Im vorletzten Absatz fordern sie das Regime in Ägypten auf, „den Weg für freie und faire Wahlen zu ebnen“. Gemeint sei damit, beteuern die Deutschen, nicht etwa die ohnehin im Herbst anstehenden Präsidentenwahlen – sondern neue Parlamentswahlen.
Ob dies nicht einem Aufruf an Mubarak gleichkäme, aufzugeben, will ein Journalist von Catherine Ashton wissen. Die Lady wirkt unsicher. „Wir wollen“, antwortet sie, „dass die Menschen selbst bestimmen können. Wir wollen uns nicht in innere Angelegenheiten einmischen.“
Dass die EU das eine tun kann und das andere lassen, das scheint Ashton in diesem Moment selbst nicht ganz zu glauben. Guido Westerwelle immerhin hat schon konkrete Wünsche an die neue Regierung. „Wir wollen nicht“, sagte er mit einiger Inbrunst zum Abschied aus Brüssel, „dass diejenigen, die Intoleranz und Fundamentalismus predigen, auf dieser Welle an die Macht gelangen, und dass die Entwicklung dann doch wieder in Unfreiheit endet.“
Der entscheidende Unterschied zwischen der Reaktion Europas und Amerikas bestand bislang darin, dass Europa bei der Forderung nach Wandel das Wörtchen „jetzt“ vermieden hat. Das erschien klug. Denn wo sind die wahrhaft demokratischen Parteien, die jetzt schon imstande wären, ein neues Ägypten zu bauen?
Heute morgen jedoch veröffentlichten die Staatschefs von Frankreich, Großbritannien, Deutschland, Italien und Spanien eine neue Position. Gleichsam als „Big Five“ erklären sie: „Nur ein zügiger und geordneter Übergang zu einer Regierung, die sich auf eine breite Basis stützt, wird es ermöglichen, die Herausforderungen, vor denen Ägypten heute steht, zu bewältigen. Der Prozess dazu muss jetzt beginnen.“
Im Privatrecht nennt man so etwas Geschäftsführung ohne Auftrag. Dass dies jeden der übrigen 22 EU-Partner begeistert, darf bezweifelt werden. Am 21. Februar treffen sich die Außenminister zum nächsten Positionsvergleich in Brüssel. Man darf gespannt sein, wie sich Europa dann neu sortiert – und für wie lange.