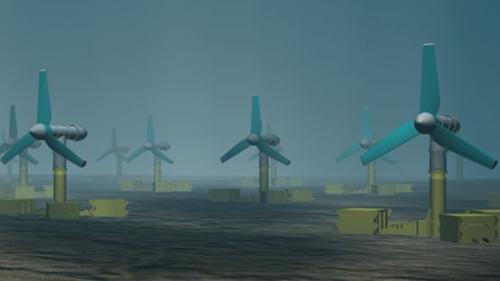Gerade einmal 100 Bürger in Schleswig-Holstein wollen sich an einer Stromleitung vor ihrer Haustür beteiligen. Das hat der Stromkonzern Tennet, der die Anleihe ausgegeben hat, am Mittwoch mitgeteilt. Er hatte rund 160.000 Haushalte in den Landkreisen Dithmarschen und Nordfriesland eingeladen, in die sogenannte Bürgerleitung zu investieren. Sie beteiligen sich an der Westküstentrasse, einer rund 150 Kilometer langen Stromleitung, die Ökostrom aus dem Norden Richtung Süden abtransportieren soll. Im Gegenzug erhalten sie eine Rendite von anfangs drei, später fünf Prozent.
Doch die Bürger sind zurückhaltend. Insgesamt konnte der Konzern nur eine Million Euro einsammeln. Nun sind alle zerknirscht, wenn nicht gar abgeklärt: Bei Tennet heißt es, dass die hohen Erwartungen immer nur von außen an den Konzern herangetragen worden seien, man selbst habe das weitaus realistischer gesehen. Tennet-Chef Lex Hartman sagte:
Der Erfolg des Projekts bemisst sich für uns nicht in der Anzahl der gezeichneten Anleihen. Im Vordergrund steht die Erweiterung unseres intensiven Dialog-Verfahrens um ein weiteres Element.
Die Erwartungen an die Bürgerleitung waren enorm und politisch aufgeladen. Es geht schließlich um die Energiewende und inwiefern die Politik die Bürger eigentlich mitnimmt. Die Bürgerleitung sollte die Lösung sein. Wenn sich Menschen aus der Region an den Gewinnen aus dem Stromnetzbetrieb beteiligen können, dann leisten sie vielleicht weniger Widerstand gegen den Bau der neuen Strommasten, die gerade in Schleswig-Holstein dringend benötigt werden. Selbst Noch-Bundesumweltminister Peter Altmaier (CDU) hatte sich für die Idee stark gemacht und betont, dass die Bürgeranleihe „erheblich dazu beitragen (könne), die Akzeptanz für den überregionalen Netzausbau zu stärken“.
Warum also war das Interesse sogar so gering, dass selbst die Zeichnungsfrist Ende August noch einmal verlängert werden musste? Ich glaube, es lag einfach an der Konstruktion des Wertpapiers. Tennet hatte es als Hybrid-Anleihe an der niederländischen Tennet Holding gestaltet – und das war sicherlich den Bürgern einfach zu kompliziert. Eine Hybridanleihe ist, vereinfacht gesagt, ein Mix aus Fremdkapital und Eigenkapital. Geht Tennet pleite, dann werden Inhaber des Bürgerleitungspapiers nur nachrangig bedient. Man ist eben kein Premiumgläubiger. Will man vorher verkaufen, ist unklar, wie hoch der Verkaufspreis sein wird, zumal es sich um einen extrem kleinen, kaum liquiden Markt handelt.
Die Verbraucherzentralen hatten daher im Vorfeld die Bürgeranleihe scharf kritisiert und sie wegen der Risiken als „ungeeignet“ für Verbraucher bezeichnet. Die NordLB, die in ihrer Analyse zum Urteil „fair“ kommt, betont auch, dass die Renditen entscheidend vom Baubeginn der Trasse abhängen. Tennet verspricht, anfangs drei Prozent Zinsen zu zahlen. Sobald allerdings der Bau losgeht, sollen es fünf Prozent sein. Anleger müssten sich, so die NordLB, bewusst sein, dass der Zinssatz vom Baubeginn, aber auch von den Bedingungen der Bundesnetzagentur abhänge, die den Stromnetzbetrieb reguliert.
„Die Anleihe war nur für risikofreudige Anleger interessant“, sagt Peter Ahmels vom Forum Netzintegration, der seit Monaten den Stromnetzausbau im Norden mitbegleitet. Den „Normalbürger“, der ja Zielgruppe gewesen sei, habe sie eindeutig nicht erreicht. Trotzdem bleibt Ahmels gelassen. „Ein Versuch war es wert.“
Und der nächste Schritt? Tennet will jetzt einen „intensiven Dialog“ mit allen Beteiligten starten. In den nächsten Wochen werden nun die Anfragen der Bürger sowie Umfragen ausgewertet. Was war falsch, was richtig? Es wird spannend, ob sich bis dahin die Politik, respektive der Bundesumweltminister, zu dem gescheiterten Pilotprojekt äußern werden. Und ob es nicht einfachere Alternativen zu einer Hybridanleihe gibt.