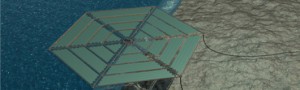Der Offshore-Netzausbau kommt nicht voran. Und Lex Hartman, der Chef des Stromnetzbetreibers Tennet, hat den Schuldigen dafür gefunden. Es ist, tatata-taaa: Bundesverbraucherschutzministerin Ilse Aigner von der CSU. Die verweigere jedes Gesprächsangebot und mache inzwischen „Parteipolitik auf Kosten der Bürger“, polterte der Niederländer heute morgen in Berlin.
Worum geht’s genau? Die Lage ist, ehrlich gesagt, verzwickt. Die Bundesregierung hat bekanntlich ambitionierte Pläne zum Ausbau der Offshore-Windenergie. Das Problem ist nur: Immer noch ist unklar, wer eigentlich zahlt, wenn da draußen auf See etwas schief geht. Was ist, wenn die Offshore-Plattform, die den Strom von Gleichstrom in Wechselstrom umwandelt, einen Schaden hat? Dann entgehen dem Windparkbetreiber schnell mal Millionenbeträge, weil er seinen Ökostrom nicht ins Stromnetz einspeisen kann. Wer übernimmt diese Kosten? Der Netzbetreiber? Seine Zulieferer? Der Stromkunde?
Die Bundesregierung hatte im August einen ersten Gesetzentwurf vorgelegt, der den Netzbetreibern entgegenkam: Sie mussten im Fall von grober Fahrlässigkeit bis maximal 40 Millionen Euro im Jahr selbst haften. Alle Kosten darüber sollten auf die Stromkunden per neuer Umlage überwälzt werden.
Dann kam Ilse Aigner – die sich bis dato nicht gerade sehr für die Energiewende auf See interessiert hatte. Sie legte, als Verbraucherschutzministerin, ihr Veto ein. Damit die Stromkunden nicht zu sehr belastet werden, erhöhte sie die Haftungssumme für die Netzbetreiber auf 100 Millionen Euro. Und zwar schon im Fall von leichter Fahrlässigkeit.
„Das ist der Tod für die Energiewende“, poltert jetzt Tennet-Chef Hartman, pünktlich vor der Anhörung im Bundestag am heutigen Montag zu dem Thema. Kein einziger Privatinvestor werde jetzt noch einsteigen und Offshore-Projekte mitfinanzieren, das Risiko sei viel zu hoch. „Leichte Fahrlässigkeit“, da könnte alles drunter fallen, sagt Hartman. „Leichte Fahrlässigkeit gibt es auf See jeden Tag.“
Gemach, gemach, möchte man da sagen. Denn erstens bringt dieses Schwarze-Peter-Spiel wenig, erst Recht nicht, wenn die Gesprächsatmosphäre vergiftet ist.
Und zweitens ist es offenbar doch nicht so schlimm, wie gedacht: Heute bestätigte Hartman auf handelsblatt.com, dass er mit dem US-Stromnetzbetreiber Anbaric über einen Einstieg verhandele: „Ja, ich habe mich mit Anbaric-Chef Ed Krapels getroffen. Und wir haben nicht über Fußball geredet“, sagte Hartman.
Jetzt ist die Frage, ob die beiden Unternehmen zusammenkommen. Wenn man Hartman glaubt, gibt es da draußen aber ausreichend privates Kapital, das sich für Investments in Stromnetze interessiere. Dank staatlicher Regulierung ist es ja ein bemerkenswert risikoarmes Business mit Garantieverzinsung.
Und wenn das alles nicht klappt, wird Deutschland am Ende doch wieder über eine Deutsche Netz AG diskutieren – also Netzbetreiber mit staatlicher Beteiligung. Spannend bleibt es allemal.