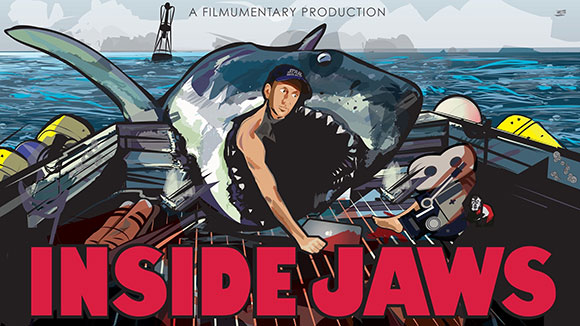Jason Schwartzman hat nicht gelogen, als er vor einigen Tagen sagte, er wüsste „nur zehn Prozent mehr“ vom Ablauf der YouTube Music Awards als die Zuschauer. Zum ersten Mal verlieh die Plattform am Sonntagabend einen Musikpreis. Live aus New York und per Stream im Internet. Mit Spike Jonze als Regisseur und Schwartzman als Moderator. Fünf Stunden Vorprogramm. Preise in sechs Kategorien. Live-Musikvideos! YouTube-Stars! Und alle so: Yeah, endlich ein Musikpreis für die digitale Generation! Doch am Ende bleiben viele Fragen offen und die Erkenntnis, dass YouTube das Genre in diesem Jahr noch nicht revolutionieren wird.
Dabei ist der Zeitpunkt eigentlich richtig: „Es ist an der Zeit, die Rolle YouTube im Musik-Ökosystem zu feiern“, sagte YouTubes Vize-Marketingdirektorin Danielle Tiedt kürzlich. Denn YouTube ist eine Macht im Musikgeschäft. Nach Analysen des Marktforschungsinstituts Nielsen hören Jugendliche bis 24 Jahre den Großteil ihrer Musik auf YouTube. Der Musikkanal Vevo alleine, an dem Google Anteile besitzt, generiert monatlich fast vier Milliarden Klicks. Und jüngst kündigte man noch an, schon bald einen eigenen Musikdienst mit einem Abo-Modell à la Spotify auf den Markt zu bringen.
Die YouTube Music Awards sind deshalb eine Chance für die Plattform, sowohl die Stellung zu festigen als auch in ein neues Gebiet vorzudringen, das in den kommenden Jahren noch wichtiger wird: Die Live-Veranstaltung. Gerade zu einer Zeit, in der mit den MTV Music Awards der mutmaßliche Platzhirsch vor allem durch die Peinlichkeiten junger Popsternchen und ewiggleicher Preisträger auffällt.
Live-Auftritte als Musikvideo
YouTube wollte es anders machen. Eigentlich. „Es wird chaotisch“, sagt Regisseur Spike Jonze schon vorher. Seine Idee war es, die Auftritte der musikalischen Gäste nicht auf einer klassischen Bühne, sondern an individuellen Sets zu filmen. Jeder Auftritt wurde somit gleichzeitig zu einem Musikvideo, ganz im Sinne YouTubes. Jedenfalls die Namen konnten sich sehen lassen: Die Britin M.I.A. performte in einem psychedelischen Lichttunnel, Eminem in düsterer Schwarzweiß-Optik, und Lady Gaga gab mit Truckerkappe und Holzfällerhemd (aber ohne Hose) am Piano eine Ballade zum Besten.
Gleich zu Beginn der Veranstaltung wechselt die Kamera zur Musik von Arcade Fire plötzlich in eine scheinbare Filmszene. Die Schauspielerin Greta Gerwig tanzt furios durch eine Wohnung und anschließend einen verschneiten Wald. Erst nach drei Minuten zoomt die Kamera heraus und die Zuschauer erkennen, dass dies alles live auf der Bühne geschieht. Die vierte Wand ist durchbrochen, der Auftritt ein frühes Highlight. Leider bleibt es fast das einzige.
Denn sobald die Moderatoren Jason Schwartzman und Reggie Watts übernehmen, kippt die Veranstaltung. Weitestgehend ohne Drehbuch soll es ablaufen. Das Ergebnis ist vor allem chaotisch, eine Anreihung von Stammeleien, von halbgaren Witzen und fragwürdiger Performancekunst. Schwartzman und Watts schnaufen mit schreienden Kleinkindern auf dem Arm ins Mikrofon, rennen durch das scheinbar wahllos umherstehende Publikum, wühlen in Torten, musizieren und verleihen fast beiläufig Preise.
YouTube-Stars nur am Rande
Ja, die gab es auch. In sechs Kategorien konnten die YouTube-Nutzer in den vergangenen Wochen abstimmen. Hier zeigte sich das vielleicht größte Problem der YouTube Music Awards: Es ging weniger um die YouTube-Stars sondern vor allem um die Künstler mit den meisten Fans. Die Nominierten in den Kategorien „Bester Künstler“, „Bestes Video“ und „Durchstarter des Jahres“ wurden nach Anzahl der Klicks und Kommentare ausgewählt. Der Rapper Tyler, the Creator, der ironischerweise selbst einen Auftritt hatte, twitterte schon vor zwei Wochen seinen Unmut heraus:
YOUTUBE AWARDS COULDVE FUCKING HAD NOMINATIONS ON COOL CREATIVE VIDEOS SHIT BUT NOOOO AGAIN ITS THE MOST TEENY BOPPER POP SHIT. YOU ARE BUTT
— Tyler, The Creator (@fucktyler) October 23, 2013
Die Gewinner hätte auch MTV nicht beliebiger aus der Retortenkiste ziehen können: Eminem, die koreanische Girlgroup Girl’s Generation und Konsens-Rapper Macklemore. Selbst in der Kategorie „YouTube Phänomen“ gewannen nicht etwa Gangnam Style oder der Harlem Shake, sondern Teeniequeen Taylor Swift.
Wo waren sie also, die „echten“ YouTube-Stars? Jene Künstler, die vor allem durch ihre Videos auf der Plattform bekannt wurden? Lediglich zwei Auftritte, nämlich von Collective Cadenza und der hüfpenden Geigenspielerin und Preisträgerin in der Kategorie „Beste Antwort“ Lindsey Stirling spendierte YouTube seinen hausgemachten Stars in 90 Minuten. Der Rest wurde im Rahmenprogramm verwurstet. Schon Stunden vor Beginn der Show streamte die Plattform Events aus London, Seoul und Rio de Janeiro mit lokalen und internationalen YouTubern. Eigentlich genau diese Art von Inhalt, die man von den YouTube Awards erwartet hätte.
Eminem won artist of the year. That's a bummer.
— Hannah Hart (@harto) November 4, 2013
Avantgarde und Albernheit
Die legen letztlich die Identitätskrise der Plattform offen: Zum einen möchte YouTube zeigen, dass es mit der Fernsehkonkurrenz mithalten kann. Dass auch die größten Namen der Musikszene auftreten und YouTube als Bestandteil der Branche sehen. Zum anderen möchte YouTube sich gerne weiterhin anarchisch präsentieren, bunter, eben anders als die alten Medien. Der Versuch, in den Music Awards beides zu verknüpfen mündete jedoch in einer Mischung aus Avantgarde und Albernheit, die auch den Zuschauern nicht entging. Gegen Ende der Ausstrahlung hatte der Livestream zwar rund 80.000 positive Bewertungen – aber auch 20.000 negative.
So wurden Erinnerungen wach an die erste Live-Veranstaltung, die YouTube vor fünf Jahren im November streamte. Bei YouTube Live standen damals die aufstrebenden, größtenteils unerfahrenen YouTuber im Mittelpunkt, die ihre eigene, chaotische wie bunte Show ablieferten. „Die Insassen betreiben die Anstalt“, frotzelte das Technikportal The Verge dieser Tage. Doch die damalige Veranstaltung enthielt mehr YouTube-Spirit als die erste Ausgabe der Music Awards. Die waren unterm Strich nichts weiter als ein weiterer Musikpreis mit den größtenteils bekannten Popkünstlern – und einem höchst anstrengenden Konzept. „I think we’re done?“, fragte Schwartzman am Ende fast unsicher in die Runde. Wenigstens das hätte ihm doch einer sagen können.
Give @YouTube this, their awards show ended early.
— VideoInk (@VideoInkNews) November 4, 2013