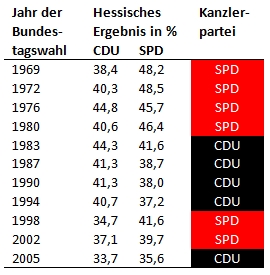Barack Obama hat den Kontinent verlassen. Aber er hinterlässt uns einige bemerkenswerte Botschaften. Neben den inhaltlichen Signalen, die dieser Tage breit diskutiert werden (Wirtschaftskrise, transatlantische Beziehungen, Afghanistan), kann man am Besuch des US-Präsidenten auch interessante Hinweise in Sachen Wahlkampf ablesen. Immerhin befindet sich der amerikanische Präsident quasi per definitionem im Dauerwahlkampf. Und während seines Besuches wurde deutlich, dass er nicht nur Staats- und Regierungschefs, sondern auch das europäische Volk von seinen Ideen überzeugen wollte. Zudem gilt der Wahlkampf Obamas seit Monaten als leuchtendes Beispiel für eine perfekt organisierte und inszenierte Kampagne. Die Amerikanisierung bzw. Obamasierung des Wahlkämpfens scheint auch in Deutschland alternativlos zu sein. Welche Erkenntnisse lassen sich also aus Obamas Auftritten für die anstehenden Wahlkämpfe in Deutschland gewinnen? Über zwei Anregungen könnten unsere Spitzenpolitiker nachdenken.
Barack Obama hat den Kontinent verlassen. Aber er hinterlässt uns einige bemerkenswerte Botschaften. Neben den inhaltlichen Signalen, die dieser Tage breit diskutiert werden (Wirtschaftskrise, transatlantische Beziehungen, Afghanistan), kann man am Besuch des US-Präsidenten auch interessante Hinweise in Sachen Wahlkampf ablesen. Immerhin befindet sich der amerikanische Präsident quasi per definitionem im Dauerwahlkampf. Und während seines Besuches wurde deutlich, dass er nicht nur Staats- und Regierungschefs, sondern auch das europäische Volk von seinen Ideen überzeugen wollte. Zudem gilt der Wahlkampf Obamas seit Monaten als leuchtendes Beispiel für eine perfekt organisierte und inszenierte Kampagne. Die Amerikanisierung bzw. Obamasierung des Wahlkämpfens scheint auch in Deutschland alternativlos zu sein. Welche Erkenntnisse lassen sich also aus Obamas Auftritten für die anstehenden Wahlkämpfe in Deutschland gewinnen? Über zwei Anregungen könnten unsere Spitzenpolitiker nachdenken.
Überzeugende Personen…
Dass Barack Obama seiner Politik ein Gesicht gibt, dass seine Person unmittelbar mit dem „Change“ verknüpft ist, ist bestens bekannt. Entsprechende Bemühungen, Personen mit Programmen zu verknüpfen, sind auch in Deutschland erkennbar. Ein Trend jedoch, auf den wir hierzulande noch warten, ist die professionelle Inszenierung des privaten Umfelds. Für die Ehepartner der deutschen Regierenden wird auf Auslandsreisen üblicherweise ein separates „Damenprogramm“ angeboten, Michelle Obama hingegen steht regelmäßig im Rampenlicht. Durch überzeugende Auftritte im vergangenen Herbst hat sie dazu beigetragen, dass die Wählerinnen und Wähler die menschliche Seite ihres Mannes kennen lernten – und auch in London, am Rande des G-20-Gipfels, galt ihr mehr Aufmerksamkeit als manchem Politiker. Auf diese Weise trägt sie ebenso wie andere Menschen aus seinem privaten Umfeld aktiv zur Persönlichkeitsbildung ihres Gatten bei. In einer letzte Woche veröffentlichten Gallup-Umfrage ist Michelle Obama unter den US-Bürgerinnen und -Bürgern mit einer Zustimmungsrate von 72 Prozent und einer Ablehnungsrate von 17 Prozent sogar noch etwas beliebter als ihr Mann (69 zu 28 Prozent). Das politische Potenzial dessen wird deutlich, wenn man auf die Zustimmungsraten im gegnerischen Lager blickt: Immerhin 48 Prozent der Republikaner befürworten Michelle Obama, ihr Mann erreicht 36 Prozent. In Deutschland hingegen werden solche Daten zu Joachim Sauer oder Elke Büdenbender gar nicht erhoben.
… haben Visionen
In Prag träumte der US-Präsident laut von einer Welt ohne Atomwaffen. Kein besonders realistisches Szenario, dennoch war das Medienecho auf diese Rede sehr positiv. Es scheint, als habe Obama hier mit einer Mischung aus Vision und Emotion den richtigen Nerv getroffen. Der enge, durch so viele Faktoren beschränkte reale Handlungsspielraum der Politik spielte einen Moment lang keine Rolle mehr. Für Deutschland könnte die Lektion hier lauten, dass auch und gerade in Zeiten der Wirtschaftskrise Visionäre gebraucht werden. Wem es gelingt, in den nächsten Monaten eine Botschaft zu entwickeln, die die Menschen berührt und die ihnen Hoffnung gibt, der hat gute Chancen gewählt zu werden. Auch wenn diese Vision nicht jeder Prüfung unter realpolitischen Gesichtspunkten auf Anhieb standhält. Die deutschen Spitzenpolitiker haben diesbezüglich Nachholbedarf: Der aktuelle „Deutschlandtrend“ von Infratest dimap (der vor der Ankunft Obamas in Europa erhoben wurde) besagt, dass 80 Prozent der Deutschen Barack Obama zutrauen, einen wichtigen Beitrag zur Lösung der Krise zu leisten. Angela Merkel kommt in der selben Befragung auf 58 Prozent, Frank-Walter Steinmeier auf 49 Prozent.
Fußnote: Natürlich waren neben den strahlenden Auftritten des US-Präsidenten auch die Probleme erkennbar, die sich mit seinem politischen Stil verbinden. Visionäre Persönlichkeiten werden gerne von verschiedenen Seiten vereinnahmt und zu Symbolfiguren erklärt (in der Werbebranche spricht man hier von „Testimonials“). So musste der Präsident in Istanbul beispielsweise den schwierigen Spagat zwischen seinen armenischen und seinen türkischen Freunden bewältigen. Er tat dies gleichwohl geschickt, indem er sich nicht direkt mit dem Genozid an den Armeniern beschäftigte, sondern stattdessen auf die Schuld seiner Landsleute an den Verbrechen an den amerikanischen Ureinwohnern verwies. Diese rhetorische Glanzleistung Obamas war dann wieder einen Eintrag ins Vokabelheft unserer Politiker wert.