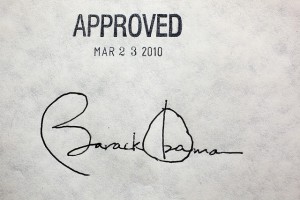Mitt Romneys Umgang mit Kritik ist bemerkenswert. Zumindest versucht der Herausforderer von US-Präsident Barack Obama nicht platt, das Thema zu wechseln oder anderweitig abzulenken, wenn er angegriffen wird. Stattdessen folgt der Republikaner offenbar einer viel perfideren Strategie: Die eigenen Schwachpunkte kann man ruhig auch mal dem Gegner vorwerfen, besser noch in einem Atemzug für sich selbst als Stärke umdeuten.
Dabei greift er gern zu zweierlei Maßstäben. Etwa wenn es um die gigantischen Erweiterungspläne für seine Villa am Strand von San Diego inklusive Aufzug für Autos geht – nicht gerade ein Zeichen von Bodenständigkeit. Angesichts der Kritik daran, solche Errungenschaften regelmäßig als Zeichen seines großen Erfolgs und Verwirklichung des amerikanischen Traums zu verkaufen, erscheint clever. In den USA lieben sie Gewinnertypen. Im Jahr 2004 aber porträtierte er den damaligen Präsidentschaftskandidaten der Demokraten John Kerry wegen seiner großen Häuser als abgehoben und fern der Sorgen des einfachen Mannes. Das ist schon dreist.
Und dieses Muster setzt sich nun im Wahlkampf um das Weiße Haus in unzähligen Varianten fort. Romney wird den Ruf nie so ganz los, ein weltfremder Multimillionär zu sein, der schon mit dem goldenen Löffel im Mund geboren wurde und sich nicht für die Durchschnittsbürger interessiert. Natürlich ist das kein Anlass, auf ganz ähnliche Kritik an Präsident Obama zu verzichten. Der habe doch viel zu viel Zeit an der elitären Harvard-Universität verbracht, sei deshalb völlig „out of touch“. Dumm nur, dass Romney genau dort sogar zwei Abschlüsse gemacht hat, also viel länger blieb als Obama.
Meine Steuer, deine Steuer
Am besten lässt sich das Spiel mit den ungleichen Maßstäben derzeit an zwei Themen beobachten: an der Auslegung des Supreme-Court-Urteils zur Krankenversicherung und immer dann, wenn es um Jobs und die Wirtschaftslage geht.
Die Krankenversicherungspflicht aus Obamas großer Reform oder vielmehr die Strafzahlung für alle, die sich nicht versichern, ist in den Augen der höchsten Richter eine Steuer – nur so konnten sie die Vereinbarkeit mit der Verfassung begründen. Diese Einschätzung kommt Romney gerade recht, kann er Obama so doch eine Steuererhöhung vorwerfen. Allerdings bleibt der Republikaner die Erklärung schuldig, warum dann die sehr ähnliche Regelung zur Krankenversicherung, die er als Gouverneur von Massachusetts eingeführt hatte, eben keine Steuer gewesen sein soll. So zumindest sieht Romney die Dinge heute. Wühlt man etwas in den Archiven, stellt man fest, dass er damals sogar kurzzeitig selbst von einer Steuer gesprochen hatte.
Und dann ist da noch die Sache mit dem Outsourcing amerikanischer Jobs ins Ausland. Obamas Wahlkämpfer haben sich mit einigem Erfolg darauf eingeschossen, Romney als Pionier auf diesem Gebiet darzustellen, der in seiner Zeit an der Spitze des Finanzinvestors Bain Capital massenhaft Arbeitsplätze vernichtet habe – die Washington Post hatte berichtet, dass Bain Capital unter seiner Führung stark in Unternehmen investiert hatte, die Jobs in Niedriglohnländer verlagerten, etwa nach China.
„Outsourcer-in-chief“
Grundsätzlich konnte Romney dies nicht abstreiten, also verhedderte er sich erst einmal in Wortklauberei: Outsourcing sei der falsche Begriff, Offshoring müsse es heißen, Arbeit in Übersee könne ja auch den amerikanischen Export stützen.
Am Ende aber warf der Kandidat Obama genau dasselbe vor: dass der Präsident mit seinem staatlichen Hilfspaket zur Ankurbelung der Wirtschaft eben auch zu verantworten habe, dass Jobs ins Ausland abwanderten. Vom Geld der Steuerzahler hätten auch viele Firmen profitiert, die im Ausland produzieren ließen. Die Republikaner gehen mittlerweile sogar so weit, ihn als „Outsourcer-in-chief“ zu bezeichnen, also genau jenen Titel aufzugreifen, den das Obama-Lager selbst in einer Anzeigenkampagne benutzt, um Romney zu diskreditieren. Das mag knapp an der Wahrheit vorbeigehen, denn das Stimulus-Gesetz beinhaltet ausdrücklich Regelungen, die sicherstellen sollen, dass die Mittel direkt amerikanischen Jobs zugute kommen.
Doch auf diese Art nimmt Romney den Angriffen wegen seiner Tätigkeit als Finanzinvestor einiges an Wucht. Mehr noch ist Obama auf diesem Feld durchaus angreifbar: Längst fordern Kritiker etwa, er müsse stärker auf Chinas Währungspolitik einwirken, um die Gefahr einer Abwanderung amerikanischer Arbeitsplätze zu verringern. Und dass seine Kampagne Marketingaktivitäten in großem Stil in Call Center im Ausland auslagert, macht seine Lage auch nicht besser.