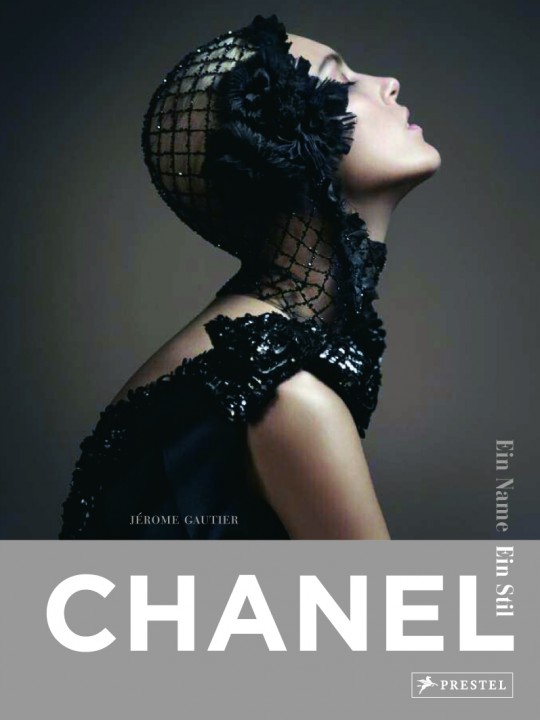Berlins Clubkultur hat immer noch den Ruf, lebendig, unberechenbar und einzigartig auf der Welt zu sein. Das liegt auch an Till Harter, einem Berliner Nachtclubbetreiber der ersten Stunde. Nach der Wende kam er in die Stadt, veranstaltete die ersten illegalen Partys in leerstehenden Häusern und machte sich mit dem 103 Club einen Namen. Danach folgte die Bar Tausend, die auch ohne Werbung erfolgreich wurde. Das Mund zu Mund-Prinzip funktionierte auch beim gehobeneren Publikum. Anfang 2013 nahm er sich vor, die Bar des neu eröffneten Luxus Boutique-Hotels “Das Stue“ im Botschaftsviertel am Rande des Berliner Tiergartens zu einem sexy Ort machen. Partys veranstaltet er aber trotzdem noch, zum Beispiel zweimal im Jahr für das ZEITmagazin zur Fashion Week. Die Hotellerie reizt ihn dennoch immer wieder. Denn das Stue Hotel gehört zur Design Hotel Community, die sich als Dachmarke für Hotels mit eigener Identität versteht. Inzwischen vermarktet die Community über 240 Inhaber geführte Hotels weltweit, der Mann dahinter: Claus Sendlinger. Er und Till Harter kennen sich schon lange. Die beiden verbindet der stete Wunsch, schöne Orte zu schaffen, mit eigener Handschrift und entspanntem Service. Vor zwei Jahren machte Sendlinger aus einem leerstehenden Backpacker-Resort direkt am Strand von Tulum, Mexiko ein PopUp-Hotel. Till Harter kümmerte sich später um das Entertainment. Jetzt, zur Weltmeisterschaft in Brasilien, veranstalten die Beiden eine fünfwöchige Party samt PopUp-Hotel in Rio de Janeiro.
ZEITmagazin: Gemeinsam mit Claus Sendlinger, dem CEO von Design Hotels, planen Sie zur WM ein PopUp-Hotel mit einem 5-wöchigen Partyprogramm in Santa Teresa, einem Stadtteil in Rio de Janeiro. Was genau ist eigentlich ein Pop Up-Hotel?
Till Harter: Im Kern geht es darum, magische Momente zu schaffen. Dafür sucht man sich einen interessanten Ort, an dem gerade etwas Spannendes passiert und bringt für eine gewisse Zeit verschiedene Menschen zusammen. Der perfekte Service ist nicht unbedingt entscheidend, vielmehr sagen wir unseren Gästen: „Hier ist euer Zimmer, wir treffen uns wieder an der Bar.“ Rio und Fussball, da treffen zwei so starke Komponenten auf einander, da mussten wir etwas machen.
ZEITmagazin: Wie muss man sich das vorstellen, Party und Hotel an einem Ort?
Till Harter: Das Konzept ist relativ lose. Man trifft sich nachmittags am Pool, es gibt Leckereien vom Grill und gute Drinks. Natürlich übertragen wir alle Spiele, es gibt Live-Musik und DJs, alles recht entspannt. Einmal die Woche veranstalten wir eine große Party, die bestimmt bis in die Nacht gehen wird. Man weiß nie, wie sehr der Ort eine Eigendynamik entwickelt. Am Sonntag organisieren wir einen tollen Brunch, bei dem ebenfalls Bands spielen werden.
ZEITmagazin: Widerspricht es nicht der gängigen Vorstellung eines Hotels – nämlich ein Ort der Entspannung zu sein – auch hier die Partys stattfinden zu lassen?
Till Harter: Das PopUp-Hotel ist kein Hotel im klassischen Sinne. Das soziale Erlebnis steht im Mittelpunkt. Wir wollen den Gästen das Gefühl geben, bei guten Freunden zuhause zu sein. Zum Beispiel haben wir eine „Honesty Bar“ eingerichtet, an der sich die Gäste selbst bedienen können. Das Haus hat nur zehn Zimmer, in denen ungefähr 20 bis 30 Leute übernachten können. Deswegen ist der andere und vielleicht viel bedeutendere Teil unseres Konzepts, das soziale Ereignis, also das Entertainment und die Partys, die während der fünf Wochen auf dem Grundstück stattfinden werden
ZEITmagazin: Sind denn noch Zimmer frei?
Till Harter: Zum Finale waren die Betten natürlich schnell weg und bis die WM losgeht, werden wir ausgebucht sein. Aber es sind noch ein paar Slots frei.
ZEITmagazin: Wie findet man so eine traumhafte Location?
Till Harter: Wir hatten wahnsinniges Glück. Kurz vor unserer Abreise aus Rio hatten wir noch keine geeignete Location gefunden, da erinnerte ich mich an das nette Pärchen, das ich mal an der Bar im Stue Hotel kennengelernt hatte und rief sie an. Sie luden uns in ihr Privathaus in Santa Teresa ein, was dann passierte, ist eigentlich unglaublich: Während wir gemeinsam auf der Terrasse beim Mittagessen saßen, erzählten sie uns, dass sie das Haus für die WM an einen Fernsehsender verpachtet hatten. In der Sekunde klingelte das Telefon und der Sender sagte ab. Dann dauerte es noch eine Weile, bis es auf beiden Seiten Klick gemacht hat. Dieses Grundstück mit den beiden Privathäusern, dem Pool und dem riesigen Garten ist wirklich ein Traum. Von der Terrasse schaut man auf die tief unter einem liegende, brodelnde Stadt, den Zuckerhut und die Strände und hört in der Ferne den Rhythmus.
ZEITmagazin: Was ist das Besondere an Santa Teresa, dem Ort der Party?
Till Harter: Rio ist eine unglaublich schöne Stadt. Inmitten der Küstenlandschaft liegen viele steile Berge, wie der Zuckerhut und der Corcovado mit der Jesusstatue. Von hier aus wächst der tropische Dschungel bis in die Stadt hinein. Oben liegen ganz malerisch die Favelas, eigentlich die schönsten Orte der Stadt. Am Strand, wie der Copacabana oder Ipanema, sind die Apartments der wohlhabenden Leute und Touristen. Eine Ausnahme ist der alte Stadtbezirk Santa Teresa, der auch auf einem Hang gelegen ist. Früher waren hier Plantagen, dazwischen stehen wunderschöne alte Kolonialhäuser. Die Gegend galt lange als gefährlich und war recht verfallen. Mittlerweile haben die Bohemians den Stadtteil für sich entdeckt und die alten Kolonialhäuser mit Liebe saniert. Eigentlich wirkt dieser Stadtteil eher wie ein großer, auf dem Berg liegender Garten, mit einmaligem Blick über Rio Downtown.
ZEITmagazin: Hört man Rio, denkt man sofort an Musik. Wie war es für Sie als langjähriger Clubbetreiber, die Stadt zu erleben?
Till Harter: Rio ist, auch was die Musik betrifft, eine zweigeteilte Stadt. In den Favelas leben viele Menschen mit afrikanischem Hintergrund, die reichen Leute am Strand haben meist europäische Wurzeln. Die hören ähnliche Musik wie wir, also elektronische Tanzmusik, House oder Hip Hop. Angepasst an die Stadt ist aber alles ein bisschen fröhlicher. In den Favelas wird Baile Funk gehört, eine raue Mischung aus Funk und Gangster Hip-Hop. Es finden riesige Baile Funk-Partys statt, organisiert und kontrolliert von der Drogenmaffia. Die sind wirklich wild und als Tourist kommt man da eigentlich nicht hin. Und dann gibt es natürlich noch den Samba, den alle hören.
ZEITmagazin: Aber Sie waren trotzdem auf einer Baile-Funk Party?
Till Harter: Ja! Da ich früher in Berlin auch Baile Funk-Partys organisiert habe, kannte ich ein paar Leute. Ein Freund, der MC ist, hat mich mitgenommen. Da schießen die Gangster wirklich mit Maschinengewehren in die Luft und es wird recht offen mit Drogen gehandelt. Es ist rau, unglaublich laut, aber voller Energie. Ich habe ja viel auf Partys gesehen, aber so etwas noch nicht. Es liegt so viel Sex in der Luft, das ist absolut großartig.
ZEITmagazin: Wie organisiert man eine 5-wöchige Party in Rio? Schifft man alles, von Möbeln bis Getränken, in die Stadt?
Till Harter: Brasilien ist noch immer ein abgeschottetes Land. Nur wenige Menschen sprechen Englisch und durch die hohen Zölle sind westliche Produkte teuer und schwer zu bekommen. Schon die einfachsten Dinge zu organisieren ist teilweise schwer. Braucht man ein Tonkabel, fährt man in Deutschland einfach zum Fachmarkt. Das gibt es in Brasilien einfach nicht. Andererseits sind die Leute wahnsinnig offen und interessiert. Ich war bisher nur zweimal für jeweils vier Tage da und kenne schon viele tolle Leute. Was die beiden Häuser in Santa Teresa betrifft, hatten wir großes Glück. Früher wurde hier schon mal ein Boutique-Hotel betrieben, das heißt die Grundausstattung war vorhanden. Beim Essen halten wir es einfach. Würde man hier versuchen, ein Fine Dining-Restaurant aufzumachen, würde man nur scheitern. Deshalb besser einfach, aber gut.
ZEITmagazin: Oft ist es ja die richtige Mischung an Gästen, die eine Party zu einer guten Party macht. Sie waren nur zwei Mal für wenige Tage selbst vor Ort. Kann man aus der Ferne überhaupt für eine gute Mischung sorgen?
Till Harter: Natürlich liegt genau darin die Herausforderung. Man muss ein Gespür dafür entwickeln, was und wer wirklich zu einander passt. Ob die Favela-Streetart-Künstler mit den französischen Modedesignern können, weiß man vorher natürlich nie. Über die sozialen Netzwerke habe ich viele Leute erreicht. Aber natürlich wird man erst, wenn es richtig losgeht, wissen, ob in Santa Teresa etwas entsteht.
Till Harter mit dem brasilianischen Künstler Vik Muniz
ZEITmagazin: Kann denn jeder, der möchte, einfach vorbei kommen?
Till Harter: Rio ist nicht ganz ungefährlich und man muss schon darauf achten, wen man einlädt. Man kann sich per Email anmelden. Es kommen Leute aus Santa Teresa und dem Rest Rios – eine sehr interessante Szene aus Künstlern, Musikern und Designern und natürlich die internationalen Gäste.
ZEITmagazin: Keine Angst, dass vielleicht sogar zu wenig Leute kommen?
Till Harter: Die Eröffnungsparty wird es entscheiden. Wenn die toll wird, spricht sich das herum. In Rio treffen sich die Menschen am liebsten am Strand. Die Bar- und Clubkultur ist sehr bescheiden und überhaupt nicht zu vergleichen mit Berlin. Aber die WM findet ja im brasilianischen Winter statt, da suchen die Leute nach Orten, an denen sie trotzdem feiern können.
ZEITmagazin: Sie selbst sagten einmal, dass Sie als Vermittler zwischen der Ost-Berliner Bohème und den Techno Freaks begonnen haben. Was reizt Sie nun an der Hotellerie?
Till Harter: Vom Clubbetreiber zum Hotelier ist es nicht weit. Schon die Betreiber des legendären Studio 54 haben die ersten Boutique-Hotels in New York gegründet. Es scheint eine logische Entwicklung zu sein. Wenn man älter wird, verkraftet man das Nachtleben nicht mehr so gut. Dann muss man sich eben überlegen, was man mit seinem Talent – schöne Plätze schaffen zu können – anfängt. So oder so ist es wichtig, dass das Konzept, die Gestaltung, das Personal und die Gegend stimmen. Man braucht ein Gespür dafür, was gerade in der Luft liegt. Dieses Aufeinandertreffen von Reisenden und Einheimischen hat etwas Beständiges, das gefällt mir.
ZEITmagazin: Trotzdem wirken viele Hotels noch immer wie Fremdkörper in der Stadt. Wie verschmilzt ein Hotel mit seinem Ort, sodass auch die Einheimischen gerne kommen?
Till Harter: Darüber machen sich innovative Hoteliers viele Gedanken. Ian Schrager und André Balazs, die vielleicht einflussreichsten Persönlichkeiten der amerikanischen Design-Hotel-Szene, haben früh den Fokus auf die Gemeinschaftsorte in ihren Hotels gelegt. Es geht immer mehr um Lobby, Bar und Restaurant, als um das Zimmer. In Deutschland hat das wenig Tradition, aber in Amerika und England ist es ganz normal, dass man in Hotels Geburtstage feiert und danach mit seiner Gruppe von der Hotelbar noch hoch ins Zimmer zieht. Selbst, wenn man nicht im Hotel wohnt.
ZEITmagazin: Wie unterscheidet sich eine Party im Club von einer im Hotel?
Till Harter: Eine Hotelbar folgt einer anderen Dramaturgie als ein Nachtclub, in den man vielleicht um ein Uhr nachts für ein paar Stunden geht. Im Hotel sehen sich die Leute, die abends zusammen gefeiert haben, morgens beim Frühstück schon wieder. Außerdem treffen sich in einem Hotel der Gast der Stadt und der Einheimische auf Augenhöhe, denn der Gast ist hier zuhause. Dann sind die Fremden der Stadt die Gastgeber und die Einheimischen die Gäste. So kommen sich die Fremden weniger fremd vor und die Leute fangen an, sich zu mischen.
ZEITmagazin: Was sind Ihre nächsten Pläne?
Till Harter: Ende nächstes Jahres werde ich mit Partnern ein eigenes Hotel in Berlin eröffnen. Es wird preislich etwas oberhalb des Michelberger Hotels angesiedelt, aber trotzdem kein Luxushotel sein. Das Berlin-Hotel eben, das es bisher noch nicht gibt. Aber mehr kann ich noch nicht verraten.
Die Fragen stellte Inga Krieger
Weitere Informationen gibt es hier oder unter: rio@designhotels.com