 Erstmals hat sich am gestrigen Freitag der Bundeswahlleiter zur Anzahl der Wahlberechtigten mit Migrationshintergrund bei einer Wahl geäußert. Auf Grundlage von Daten des Mikrozensus 2007 kommt er auf insgesamt 5,6 Millionen. Das entspricht 9 Prozent aller Wahlberechtigten und damit wahrscheinlich mehr als bei jeder vorherigen Bundestagswahl. 2,6 Millionen seien Spätaussiedler, 2,1 Millionen eingebürgerte Zuwanderer. Hinzu kämen 290.000 Personen mit Migrationshintergrund, die in Deutschland geboren wurden sowie 566.000 Deutsche, die mindestens ein Elternteil mit Migrationshintergrund haben. Als Hauptherkunftsländer werden Polen mit 762.000, Russland mit 705.000, Kasachstan mit 442.000, die Türkei mit 327.000 in der ersten und 149.000 in der zweiten Generation sowie Rumänien mit 313.000 Personen genannt.
Erstmals hat sich am gestrigen Freitag der Bundeswahlleiter zur Anzahl der Wahlberechtigten mit Migrationshintergrund bei einer Wahl geäußert. Auf Grundlage von Daten des Mikrozensus 2007 kommt er auf insgesamt 5,6 Millionen. Das entspricht 9 Prozent aller Wahlberechtigten und damit wahrscheinlich mehr als bei jeder vorherigen Bundestagswahl. 2,6 Millionen seien Spätaussiedler, 2,1 Millionen eingebürgerte Zuwanderer. Hinzu kämen 290.000 Personen mit Migrationshintergrund, die in Deutschland geboren wurden sowie 566.000 Deutsche, die mindestens ein Elternteil mit Migrationshintergrund haben. Als Hauptherkunftsländer werden Polen mit 762.000, Russland mit 705.000, Kasachstan mit 442.000, die Türkei mit 327.000 in der ersten und 149.000 in der zweiten Generation sowie Rumänien mit 313.000 Personen genannt.
Die Gesamtzahl der Wahlberechtigten mit Migrationshintergrund scheint damit höher zu sein als bislang angenommen. Ich selbst kam auf der Grundlage des Mikrozensus (MZ) 2005 auf schätzungsweise 4,1 Millionen Wähler mit Migrationshintergrund. Wie der Bundeswahlleiter machte ich die Sowjetunion und ihre Nachfolgestaaten (ca. 1 Million), gefolgt von Polen (ca. 500.000), der Türkei (ca. 500.000) und Rumänien (ca. 300.000) als wichtigste Herkunftsländer aus. Während also die Angaben für die Herkunftsländer sehr ähnlich sind, ergibt sich doch eine erstaunliche Differenz bei der Gesamtzahl der Wahlberechtigten mit Migrationshintergrund.
Die Materie ist – zugegebenermaßen – komplex, denn im Mikrozensus wird, übrigens erst seit 2005, zwischen etlichen Personen(-gruppen) mit Migrationshintergrund differenziert. Da sind zunächst diejenigen mit eigener Migrationserfahrung und diejenigen ohne eigene Migrationserfahrung. Beide Gruppen kann man unter anderem danach differenzieren, ob die deutsche Staatsbürgerschaft ohne Einbürgerung oder erst durch Einbürgerung vorliegt. Auf der Grundlage des MZ 2005, der ein wenig verlässlicher über den Migrationshintergrund Auskunft geben kann als der MZ 2007, komme ich auf 7,7 Millionen Deutsche mit Migrationshintergrund. Da die Verteilung nach Altersgruppen für Wahlforscher ungünstig ausgewiesen wird (die 15- bis 20-Jährigen bilden eine Gruppe), kann die Zahl der Wahlberechtigten (also derjenigen ab 18 Jahren) auf der Grundlage der publizierten Ergebnisse nicht exakt beziffert werden. Ich kam und komme durch eine Schätzkalkulation für 2005 auf insgesamt 5,1 Millionen wahlberechtigte Deutsche mit Migrationshintergrund – nach der Definition „Migrationshintergrund“ des Mikrozensus. Es ist plausibel, dass sich diese Zahl seit 2005 auf nun 5,6 Millionen erhöht hat.
Nun vermute ich allerdings, dass die Zahl der Personen mit Migrationshintergrund im Mikrozensus zu hoch ist. Dabei bestehen überhaupt keine Probleme bei den Eingebürgerten und den Befragten mit Migrationshintergrund der zweiten Generation. Als problematisch betrachte ich aber die Gruppe der „Deutschen mit eigener Migrationserfahrung, die nicht eingebürgert wurden“. Diese Gruppe umfasst im MZ 2005 1,77 Millionen. Laut Definition des Mikrozensus fallen hierunter „Spätaussiedler, Flüchtlinge und Vertriebene deutscher Volkszugehörigkeit ohne Einbürgerung“. Diese Personen und Gruppen sind unzweifelhaft gewandert (größtenteils unter erheblichem Zwang), aber sollte man ihnen deshalb auch gleich das Etikett „Migrationshintergrund“ anheften? Durch den expliziten Ausschluss von Personen, die vor 1949 zugewandert sind und derjenigen, die vor 1949 mit ausschließlich deutscher Staatsangehörigkeit geboren wurden, versucht der MZ immerhin, die Kriegsjahre und folgen auszuklammern. Ob dies dadurch gelingt, ist zumindest mir nicht klar. Aussiedler und (ab 1993) Spätaussiedler mussten sich jedenfalls bis Juli 1999 einbürgern lassen und fallen daher nach meinem Kenntnisstand in der Regel nicht in diese Gruppe. Wer aber dann?
Aufgrund dieses potenziellen Problems mit der Gruppendefinition „Deutsche mit eigener Migrationserfahrung, ohne Einbürgerung“ habe ich versucht, zu quantifizieren, wie viele Spätaussiedler seit 1999 ohne Einbürgerung nach Deutschland gekommen sind. Laut MZ 2005 sollten es für die Jahre 1999 bis 2004 („Deutsche mit eigener Migrationserfahrung, ohne Einbürgerung, seit weniger als 6 Jahren in Deutschland“) etwa 397.000 sein. Hinzu kommen für die Jahre 2005 bis 2009 weitere rund 50.000 Spätaussiedler (Annäherung, da addierte Zuzugszahlen). Dies sind gerade einmal knapp 450.000. Bei informierter Schätzung der Wahlberechtigten unter diesen 450.000 (exakte Zahlen liegen mir nicht vor) komme ich auf knapp 400.000 Deutsche mit eigener Migrationserfahrung, die seit 1999 nach Deutschland gekommen sind und nicht mehr formal eingebürgert wurden. Demnach kalkuliere ich auf der Basis des MZ 2005 rund 3,9 Millionen Wahlberechtigte mit Migrationshintergrund, zu denen ich noch diejenigen Deutschen hinzugerechnet habe, die nicht eingebürgert wurden, aber eine eigene Migrationserfahrung haben und aus binationalen Ehen stammen (199.000). Dies ergibt zusammen die von mir genannten 4,1 Millionen.
Alles nur definitorisches Klein-Klein oder lässt sich auch etwas schlussfolgern? Meiner Ansicht nach gibt es auf Grundlage des Mikrozensus 2005 mindestens 4,1 Millionen Wahlberechtigte mit Migrationshintergrund, für die diese Bezeichnung auch treffend ist. Berücksichtigt man die vom Bundeswahlleiter genannten Erstwähler auf der Grundlage des Mikrozensus 2007, dann haben nun möglicherweise 4,5 bis 4,6 Millionen Wahlberechtigte einen Migrationshintergrund. Dies ist eine konservative Schätzung – weniger Wahlberechtigte mit Migrationshintergrund wird es wohl nicht geben.
Ich will aber nicht ausschließen, dass die Zahl der Wähler mit Migrationshintergrund insgesamt höher ist und bis zu 5,6 Millionen – wie vom Bundeswahlleiter beziffert – beträgt. Als Wissenschaftler, der sich schon länger mit dem Thema beschäftigt, wären diese höheren Zahlen sogar eine hervorragende Nachricht und unterstrichen die Bedeutung dieses Forschungsbereichs. Andererseits ist mir, gerade als Wissenschaftler, die Definition der Gruppe „Deutsche mit eigener Migrationserfahrung, ohne Einbürgerung“ mit zu vielen Unwägbarkeiten behaftet, als dass ich bislang von der Validität dieser Gruppengröße überzeugt wäre. Es bedarf weiterer Informationen und wahrscheinlich eines Einblicks in die Daten des Mikrozensus (am besten, sobald dann die 2009er Daten vorliegen), um zu einer abschließenden Beurteilung zu kommen.
Letztlich ist es aber begrüßenswert, dass sich nun auch der Bundeswahlleiter der (wahlberechtigten) Bürger mit Migrationshintergrund angenommen hat. Dies könnte der Auftakt zu einer intensiveren Beschäftigung mit dieser Wählergruppe (siehe z.B. Skandinavien) sein. Ich würde sehr begrüßen, wenn es bald einmal Wahlbeteiligungsanalysen für diese Gruppe auf der Grundlage einer erweiterten Repräsentativen Wahlstatistik gäbe, denn über die Wahlbeteiligung in der Gruppe der Wahlberechtigten mit Migrationshintergrund wissen wir in Deutschland immer noch viel zu wenig.


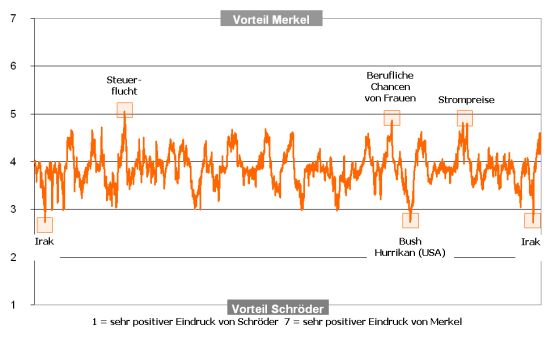

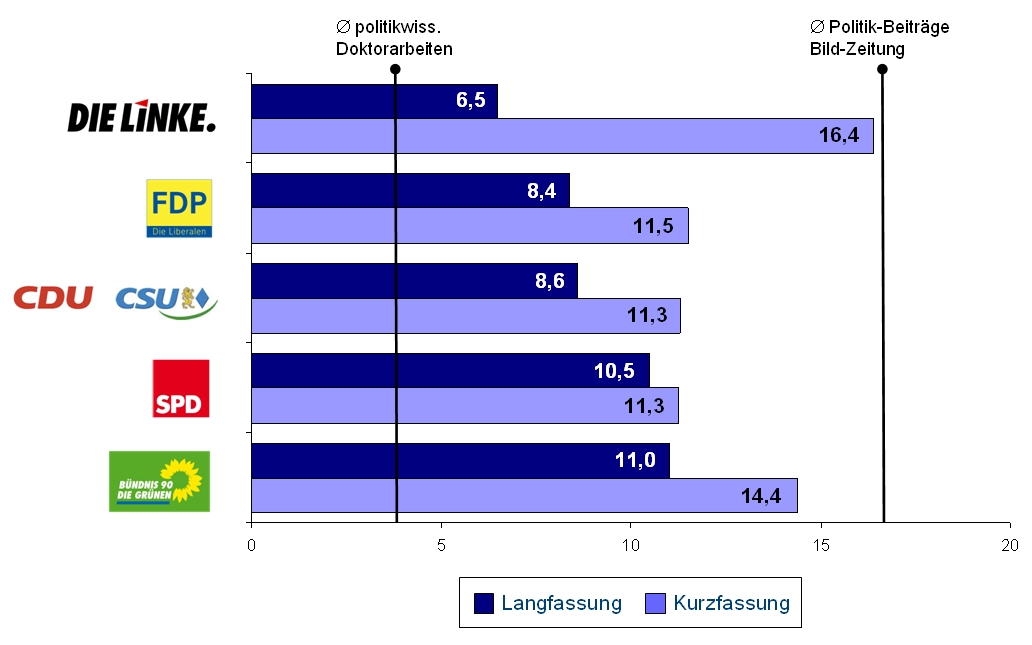





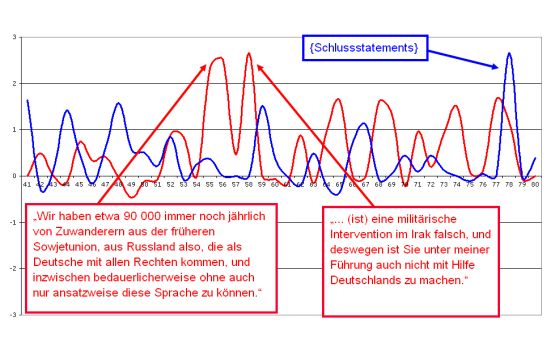
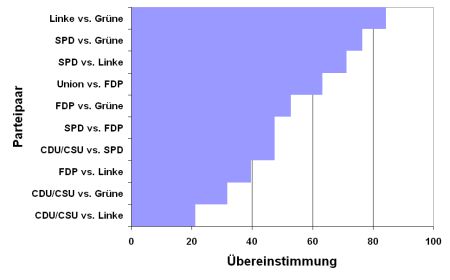
 Angela Merkel möchte, so ist
Angela Merkel möchte, so ist 