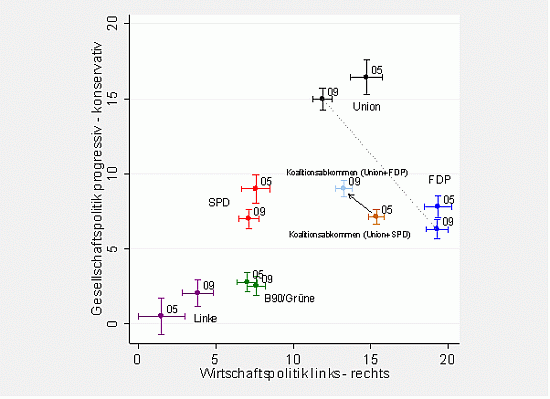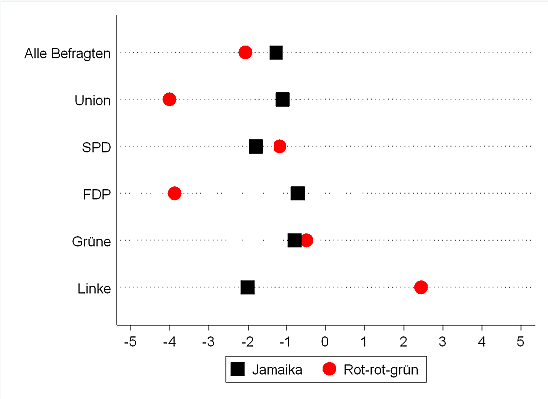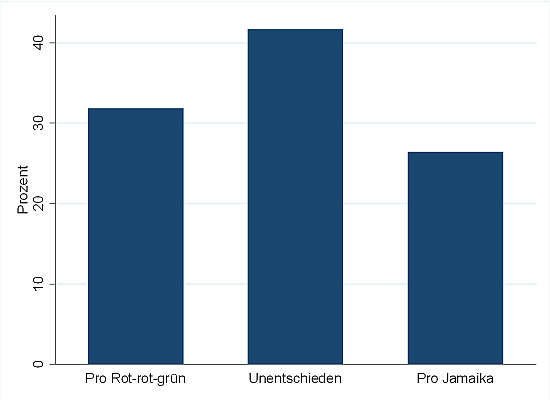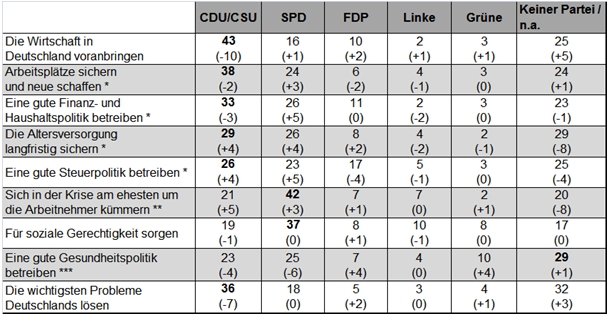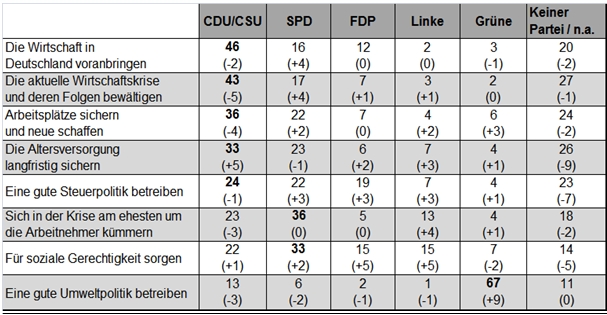In den Tagen nach der Bundestagswahl haben mein Kollege Helmut Norpoth und ich das Abschneiden unseres Kanzlermodells näher untersucht. Die nachfolgende Analyse ist das erste Ergebnis unserer gemeinsamen Bemühungen.
In den Tagen nach der Bundestagswahl haben mein Kollege Helmut Norpoth und ich das Abschneiden unseres Kanzlermodells näher untersucht. Die nachfolgende Analyse ist das erste Ergebnis unserer gemeinsamen Bemühungen.
Das Wahlergebnis vom 27. September zeigt eines ganz deutlich: Der Regierungswechsel wird kommen. CDU/CSU haben zusammen mit der FDP eine Mehrheit im neuen Bundestag erreichen können. Im Gegensatz zu einigen Kommentatoren und Umfragen, die noch kurz vor dem Wahltag einen solchen Ausgang für unwahrscheinlich hielten und stattdessen eher eine Wiederauflage der „Großen Koalition“ voraussahen, hat das Kanzlermodell erneut den richtigen Sieger vorhergesagt. Schwarz-Gelb. Trotz der zugegebenen schwierigen Ausgangssituation im Jahr 2009 mit einer amtierenden Regierung, die eigentlich gar nicht wiedergewählt werden wollte, prognostizierte unser Modell wie bei allen anderen Wahlen zuvor wieder einmal den richtigen Sieger. Und das nicht erst am Wahlabend oder mit lauten Zweifeln, sondern schon lange vor dem Wahltag.
Der tatsächlich erreichte Prozentsatz für Schwarz-Gelb von 48,4 % weicht von unserem am 20. August vorhergesagten Wert (52,9 %) um 4,5 Prozentpunkte ab. Obwohl wir den Ausgang richtig vorhergesagt haben, war das Modell offensichtlich großzügiger zur Wunschkoalition der Kanzlerin als die Wählerinnen und Wähler am Wahltag selbst. Natürlich ist nicht jedesmal ein Volltreffer zu erwarten wie 2002 oder nur eine geringfügige Abweichung wie 2005, als unsere Modellprognosen besser abschnitten als die Umfrageergebnisse vor und am Wahltag selbst. Allerdings irrte sich dieses Mal unser Modell weit mehr als die Umfragen.
Warum wurde der Stimmenanteil von Schwarz-Gelb derart überschätzt? Wir können natürlich nicht in die Köpfe der Wähler hineinschauen, vermuten aber Folgendes: Die Umsetzung von Popularität vor der Wahl in Stimmen am Wahltag hat für die schwarz-gelbe Wunschkoalition der Kanzlerin nicht so funktioniert, wie wir das von den anderen Bundestagswahlen her kannten. Leider sind bisher noch keine Umfragedaten, die eine genauere Analyse ermöglichen würden, öffentlich zugängig. Trotzdem gibt es Anzeichen, die diese Vermutung stützen.
Popularität von Merkel und Steinmeier bei ihren eigenen Anhängern im Jahr 2009
| 2009 |
Merkel wird bevorzugt von CDU/CSU-Anhängern |
Steinmeier wird bevorzugt von SPD-Anhängern |
| Juli I |
89 |
62 |
| Juli II |
91 |
50 |
| Aug I |
93 |
53 |
| Aug II |
92 |
55 |
Quelle: Veröffentlichte Werte im Bericht zum Politbarometer der Forschungsgruppe Wahlen
Die Anhänger der SPD standen nicht deutlich hinter ihrem Kanzlerkandidaten. Die Unterstützungswerte von Steinmeier lagen nur bei rund 55 %. Offensichtlich hat die hypothetische Entscheidung „Merkel oder Steinmeier?“ die eigenen SPD-Reihen nicht so fest geschlossen wie das üblicherweise der Fall ist. Viele wünschten sich Frau Merkel anstelle des eigenen Kandidaten als Bundeskanzler(in), ohne jedoch für die Union zu stimmen. So war Frau Merkel vor der Wahl populärer als die Bundeskanzler bei früheren Wahlen. Das lag hauptsächlich an der besonderen Situation der amtierenden „Großen Koalition.“ Die SPD gehörte einer Regierung an, die nicht von einer Persönlichkeit aus der eigenen Partei, sondern aus der Gegenpartei geleitet wurde. Es gab offenbar SPD-Anhänger, die es ohne weiteres mit sich vereinbaren konnten, einerseits lieber die Amtsinhaberin anstelle des eigenen Kandidaten als Kanzler zu bevorzugen, aber am Wahltag doch der eigenen Partei ihre Stimme gaben statt ihrer Wunschkanzlerin ins Amt zu verhelfen. Vermutlich waren viele Wähler derart an die „Große Koalition“ gewöhnt, dass sie trotz gegenseitiger Konfrontationen im zurückliegenden Wahlkampf zu solch einem gefühlten Spagat fähig waren. Dieser Umstand bescherte 2009 der amtierende Kanzlerin bei SPD-Anhängern Sympathien, einen „Großer Koalitions-Bonus“ sozusagen, die bei Wahlen ohne Grosse Koalition nicht zu erwarten sind. Ein Vergleich von Kanzlerpopularität in den Reihen der Parteianhänger mit Kanzlerpopularität vergangener Wahlen beweist das eindeutig.
Wir haben uns daraufhin die veröffentlichten Berichte der Forschungsgruppe Wahlen zum Politbarometer angesehen, auf deren Basis wir unser Maß für die Kanzlerpopularität konstruierten. Zudem haben wir auch die von der Forschungsgruppe Wahlen dankenswerterweise archivierten Daten für 2002 reanalysiert.
Popularität von Stoiber und Schröder bei ihren eigenen Anhängern im Jahr 2002
| 2002 Ost |
Stoiber wird bevorzugt von CDU/CSU-Anhängern |
Schröder wird bevorzugt von SPD-Anhängern |
| Feb |
81 |
95 |
| Mär |
85 |
96 |
| Apr |
82 |
95 |
| Mai |
83 |
93 |
| Jun |
81 |
93 |
| Jul |
81 |
95 |
| Aug |
78 |
97 |
| Sep |
87 |
99 |
| 2002 West |
Stoiber wird bevorzugt von CDU/CSU-Anhängern |
Schröder wird bevorzugt von SPD-Anhängern |
| Feb |
91 |
96 |
| Mär |
89 |
93 |
| Apr |
89 |
95 |
| Mai |
87 |
96 |
| Jun |
89 |
94 |
| Jul |
88 |
95 |
| Aug |
88 |
98 |
| Sep |
88 |
99 |
Quelle: Erhebungen der Forschungsgruppe Wahlen
Vor der Wahl 2002, als die eine Großpartei (SPD) im Amt und die andere (CDU/CSU) in der Opposition war, erfreuten sich Kanzler Schröder wie auch Kanzlerkandidat Stoiber nahezu voller Unterstützung in den eigenen Reihen. In Ost wie West. Zwischen 80 und 90 % der CDU/CSU- Anhänger wünschten sich lieber Stoiber als Schröder als Kanzler. Über 90 % der SPD-Anhänger wünschten sich lieber wieder Schröder.
Für 2005 ergibt sich im Wesentlichen dasselbe Bild. Hier berufen wir uns auf die veröffentlichten Werte im Politbarometer. Beide Kanzlerkandidaten konnten unter den jeweiligen Parteianhängern klar polarisieren. Während die damalige Herausforderin sich auf rund 80 % Zustimmung im eigenen Lager verlassen konnte, konnte der Amtsinhaber auf rund 90 % seiner Anhänger zählen. Ein solches Muster ist typisch für den Normalfall einer Bundestagswahl, wo CDU/CSU und SPD auf entgegengesetzten Seiten der Macht stehen.
Popularität von Merkel und Schröder bei ihren Anhängern im Jahr 2005
| 2005 |
Merkel wird bevorzugt von CDU/CSU-Anhängern |
Schröder wird bevorzugt von SPD-Anhängern |
| Jul I |
79 |
92 |
| Jun II |
75 |
89 |
| Jun I |
83 |
88 |
| Mai |
81 |
91 |
Quelle: Veröffentlichte Werte im Bericht zum Politbarometer der Forschungsgruppe Wahlen
Für den seltenen Fall einer Wahl wie der in 2009, wo diese beiden Parteien gemeinsam im Amt sind, wäre es ratsam, die Variable „Kanzlerpopularität“ im Prognosemodell entsprechend zu bereinigen. Insbesondere dann, wenn die Wahlprognose auf eine andere Parteienkombination abzielt, also Schwarz-Gelb statt Schwarz-Rot. Nehmen wir also den typischen Fall, in dem sich die beiden Großparteien gegenüberstehen: Hier finden die beiden Kanzlerkandidaten etwa die gleiche Zustimmung in den eigenen Parteilagern. Unter dieser Annahme erhielten wir für 2009 einen vom „Großen Koalitions-Bonus“ bereinigten Wert für die Kanzlerpopularität von 61 % für die amtierende Kanzlerin. Mit einem solchen Popularitätswert hätte unser Modell sodann eine Prognose von 49,1 % Stimmen für Schwarz-Gelb geliefert. Bei einem solchen Sonderfall wie in 2009, ist eine solche Korrektur sicherlich zu rechtfertigen. Die Kanzlerpopularität eignet sich ohne weiteres als Prognosefaktor bei Wahlen, in denen sich die Kanzlerkandidaten wie auch die hinter ihnen stehenden Parteien auf entgegengesetzten Seiten befinden. Wenn beide Großparteien jedoch zusammen im Amt sind und mit eigenen Kanzlerkandidaten antreten, dann hat die Kanzlerpopularität nur bedingte Prognosekraft für eine andere Kombination von Parteien.
 Mit dem Wechsel von Dieter Althaus zum Autozulieferer Magna beobachten wir wieder einmal den engen Zusammenhang zwischen Politik und Wirtschaft, nachdem erst kürzlich der Wechsel eines Vertreters der privaten Krankenkassen in das Gesundheitsministerium für Aufruhr gesorgt hatte. In solchen Zusammenhängen wird gerne von der „gekauften Republik“, von „Lobbykratie“ etc. geredet. Dies soll hier aus der Sicht der empirischen Sozialforschung in aller Kürze unter Berücksichtigung der neuen Forschungsergebnisse beleuchtet werden. Denn dass das Thema auch aus akademischer Sicht relevant ist, zeigen nicht zuletzt die Debatten, die derzeit in der Politischen Vierteljahresschrift (PVS) und der Zeitschrift für Politikberatung (ZPB) geführt werden.*
Mit dem Wechsel von Dieter Althaus zum Autozulieferer Magna beobachten wir wieder einmal den engen Zusammenhang zwischen Politik und Wirtschaft, nachdem erst kürzlich der Wechsel eines Vertreters der privaten Krankenkassen in das Gesundheitsministerium für Aufruhr gesorgt hatte. In solchen Zusammenhängen wird gerne von der „gekauften Republik“, von „Lobbykratie“ etc. geredet. Dies soll hier aus der Sicht der empirischen Sozialforschung in aller Kürze unter Berücksichtigung der neuen Forschungsergebnisse beleuchtet werden. Denn dass das Thema auch aus akademischer Sicht relevant ist, zeigen nicht zuletzt die Debatten, die derzeit in der Politischen Vierteljahresschrift (PVS) und der Zeitschrift für Politikberatung (ZPB) geführt werden.*