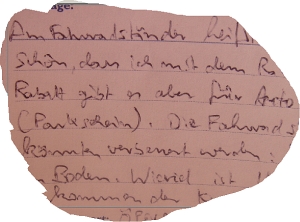Wenn es heiß ist, geht man an einen Badesee. Da entspannt man sich und sammelt Kräfte für alles, was da kommt. Dieses Geheimnis wird von Generation zu Generation weitergegeben, und im Großen und Ganzen funktioniert das auch. Außer man wohnt in Berlin. Da funktioniert das inzwischen nicht mehr so richtig gut. In Berlin ist das nämlich so: Man steigt am Schlachtensee aus der S-Bahn, trägt einen vorschriftsmäßigen Picknickkorb am Handgelenk, darin einige Flaschen des kühlen Pilsbieres, vielleicht gar ein sanftes Frikadellchen oder auch gesalzenes Gebäck. Nun sucht man sich auf der proppevollen Liegefläche einen ungenutzten Quadratmeter, entrollt eine Badematte, legt sich ein Handtuch unter den Kopf und macht eine kleine Schläferei.
Macht man eben nicht, weil unten am Ufer jemand abgestochen wird. So hört es sich zumindest an. Wenn man genauer hinschaut, sieht man, dass es nur eine achtköpfige Meute muskelbepackter Männer, dem Installateur- oder Gerüstbauerhandwerk zuzuordnen, ist, aus Leibeskräften schreiend, die damit beschäftigt sind, sich gegenseitig ins Wasser zu schmeißen, sich im Wasser zu balgen, mit einem Medizinball zu bewerfen, brüllend wieder aus dem Wasser zu steigen, nur um sich subito wieder ins Wasser zu stürzen. Ein perpetuum mobile der Grobheit, ein Sisyphos-Treiben. Man schaut zunächst missmutig, nach einigen Minuten fasziniert auf dieses Treiben, das ohne jeden Zweck erscheint, ungerecht und erratisch anmutend werfen die Menschen einander ein ums andere Mal ins Wasser, brüllen und johlen, es nimmt kein Ende, sie haben schier unerschöpfliche Energievorräte, immer weiter geht das, es ist einfach sagenhaft. Gerade, als man sich daran gewöhnt hat, kommt er. Der Nebel. Dichter, dichter Nebel. Er kommt von einem kleinen Alu-Grill. Von einem kleinen Alu-Grill, der offenbar falsch bedient wird. Von einem kleinen Alu-Grill, der nicht nur falsch bedient wird, sondern hier eigentlich gar nichts zu suchen hat. Zwei grüngesichtige juvenile Deppen kokeln an dem Grill herum, operieren mit Kohle, Grillanzündern und Spiritus, die Rauchschwaden werden dichter und dichter, sie ziehen mit pestilenzartigem Gestank in Richtung Badewiese. Erste Rufe werden laut: „ßndisda? Seid wohl bekloppt, wa. Gloobck nicht, grilln die hier, áschlöcha.“ Nun werden die Deppen hektisch, wedeln mit bloßen Händen über der Feuerstelle hin und her und verstärken damit den Qualmaustritt auf das Zehnfache. Schnell formiert sich aus den im Qualm sitzenden ein Mob, der sich im Halbkreis um die Grill-Anfänger herum aufbaut und skandiert, „ausmachen, ausmachen ihr Spastis“: Irgendwer erbarmt sich und gießt einen halben Liter Wasser in die Glut. Langsam kehrt Ruhe ein. Habe ich Ruhe gesagt? Langsam kehrt der Lärm auf den Ursprungspegel zurück. Die gerade erwähnten Installateure frönen weiterhin ihrem debilen Spiel, dessen finales Ziel es wohl sein soll, dass alle Mitspieler ertränkt werden. Es ist wirklich erstaunlich, wie sehr sie schreien können, ohne heiser zu werden. Immer wieder hört man das laute Klatschen von Arschbomben auf dem Wasser. Gejohl wird abgelöst von lautem Gejohle, das wiederum abgelöst wird von extralautem, superlautem Spezialgejohl und rekordverdächtigem 1a Spitzen- Gejohl mit optionalem Schwerst-Wasserspritzen.
Nun kommen andere Schwaden angeraucht. Vier struppige Menschen sitzen nebenan, die schlimmste Sorte Mensch, die es gibt: Weiße mit Dreadlocks. Schwaben, die erst 2009 die Band Rage against the Machine entdeckt haben, auf Hochbetten schlafen und Ben Becker für Subkultur halten. Sie sitzen da und kiffen. Nun, das soll mir ausnahmsweise recht sein, das geht wenigstens leise vonstatten. Erleichtert entkronkorkt man ein Pilsbier, nimmt einen geziemenden Schluck, fast sind einem nun auch die johlenden Wasserspritzer vom Ufer sympathisch, es macht sich eine Art Frieden breit. Doch da hört man den Klang des Sommers 2009. Der Klang des Sommers 2009 ist der Klang eines Nokia-Handys, auf dem Musik über den Lautsprecher abgespielt wird. Falls es nicht bekannt sein sollte, erkläre ich es hier kurz: Die täglich mehr werdenden Deppen dieser Welt haben alle zusammen Anfang des Jahres einen Brief an Nokia geschrieben, weil sie festgestellt haben, dass ihr vorsätzlich ausgeübtes MP3-Player-Kopfhörergezischel inzwischen niemanden mehr in Bus und Bahn nervt. „Lieber Nokia“, so haben sie geschrieben, „niemand beachtet uns mehr. Niemand zollt uns Respekt. Wir werden ignoriert, und das darf nicht sein, denn unser Daseinssinn und -zweck ist es, der Menschheit eine wahrhaftige Geißel zu sein, auf dass wir ihre Toleranz prüfen könnten. Daher, lieber Nokia, erfinde uns doch bitte etwas, das laut und klein ist und plärrt und nervt, am Besten ein Musikabspielgerät was unsere ganzen vier oder fünf mp3-Dateien, die wir beistzen, in möglichst hässlichem Klang abspielen kann. Könnt ihr das?“ – „Ja“, haben die Nokias geantwortet, „das können wir.“ Und dieser Klang kleiner, plärrrender Handys, das ist der Klang des Sommers 2009.
Ich höre also nun aus 8 cm Luftlinie ein Nokia N95, das einen mir unbekannten Aggro-Rap-Soundtrack bereitstellt. Irgendwas unmelodisches von einem Diddy O. oder Puff Diddy, einem dieser goldverplombten Rapper mit Gestikulierkrankheit, die jedes Mal schon für das Wechseln ihres Namens oder der Straßenseite oder für das Einsteigen in ein Automobil mehrere Millionen Dollar kassieren. Ich öffne vorsichtig meine Augen. Eigentlich muss ich es nicht, weil ich sowieso weiß, was ich sehen werde, aber es ist wie ein Unfall. Man schaut eben doch hin. Ich sehe einen gegelten, jungen Mann, er steht dort in einer Khaki-Hose, einem Nike-T-Shirt und Nike-Turnschuhen, deren Gegenwert recht genau meiner monatlichen Umsatzsteuervorauszahlung entspricht. Er hat eine monströse, leuchtend weiße, um 35 Winkelminuten phasenverschobene Baseballkappe auf, und zwar eine, deren halbrunder Hut-Teil an seiner höchsten Erhebung fast 50cm hoch ist und deren Krempe breit und lang genug wäre, einem ausgewachenen Iglo-Schlemmerfilet Schatten zu spenden. Er steht da, hält auf Hüfthöhe sein Handy in der Hand und schaut herum. Sonst tut er nichts. Er tut nur einfach da stehen. Und hoffen, dass man ihn bewundert oder hasst. Er möchte auf jeden Fall eine Reaktion. Dazu ist er da. Und deshalb reagiere ich auch nicht. Ich ignoriere ihn.
Erst nach einer Viertelstunde merke ich, dass er offenbar nur 4 MB Speicher im Handy hat, er spielt jedenfalls immer wieder das Lied von vorne. Das bekommt mir nicht, das weiß ich noch von der Popkomm 1998, auf der ich – als männliche Hostess arbeitend, insgesamt 25.000 mal das Lied „Samba di Janeiro“ hören musste und darob richtig gehend krank wurde. Mit Fieber. Ich schaue den Morgenländer also an. Er schaut zurück. Ja, jetzt hat er mich da, wo er mich haben wollte. Ich schaue nochmal. Er schaut zurück. „Könnten Sie sich bitte ein wenig zur Seite stellen? Oder die Musik leiser machen? Ich würde gerne etwas schlafen“.
Und ja – der junge Mann nickt mir zu. So geht’s. Liebe Berliner, ich habe gerade ein Beispiel gegeben, wie man das macht. Respektvoll, höflich, mein Gegenüber auf Augenhöhe angesprochen. Und zack – da nickt er! Er bleibt allerdings da stehen, wo er stand. Auch lässt er die Musik weiter laufen. Ich warte einige Minuten. Wiederhole dann, auf sein Handy zeigend, „Entschuldigung. Die Musik. Leiser bitte. Oder woanders hin gehen. Bitte.“. Er nickt wieder, sonst ändert sich jedoch nichts.
Ich zücke mein Nokia N95 und steppe durch die Songdatenbank meiner 1 Gigabyte Mini-SD Karte. Was nehmen wir denn. Dinosaur Junior? Die Babyshambles? Interpol? Oder kann man ihn mit Reggae quälen? Linton Kwesi Johson? Nein, wir nehmen Frank Zappa, Apostrophe, ein sechsminütiger Fieberwahn, das muss funktionieren. Ich schalte ein. Der Aggro-Rap ist nicht mehr zu hören, er ist maskiert, wie die Tontechniker das nennen. Mein Zappa ist einfach lauter. Ich bin froh, dass ich vor dem Überspielen aufs Handy alle Lieder nochmal per Software komprimiert habe. Der junge Mann geht weg. Das wiederum macht mir so gute Laune, ich glaube, ich ziehe jetzt mal meine Badehose an und gehe mit den Klempnern und Gerüstbauern plantschen