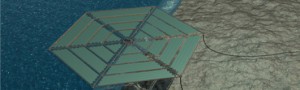Die Idee ist ja simpel: Warum sollen sich Bürger nicht nur finanziell an Windrädern beteiligen, sondern nicht auch an Stromleitungen? Bürgernetz lautet die Idee, über die wir bei ZEIT ONLINE ja schon öfter berichtet haben. Die Arge Netz, ein Zusammenschluss von Windparkbetreibern, und das Stromnetzunternehmen Tennet wollen in Schleswig-Holstein das erste Bürgernetz Deutschlands realisieren.

Bei Friesen (und Dithmarschern, wie ich gelernt habe) stößt die Idee auf eine überraschend große Nachfrage: Mehr als 100 Personen haben in den vergangenen Wochen ernsthaftes Interesse bekundet, teilweise sogar schon konkrete Euro-Beträge als Beteiligung genannt. Und dass, obwohl das Bürgernetz noch gar nicht beworben wird. „Die Zustimmung ist enorm, täglich melden sich Leute bei uns und wollen mitmachen“, sagt Arge-Geschäftsführer Martin Grundmann.
Mindestens fünf Prozent Rendite schweben Grundmann und Bundesumweltminister Peter Altmaier vor. Der Minister unterstützt die Idee und hat eine Beteiligung von rund 500 Euro ins Spiel gebracht. Die Rendite ist nicht unrealistisch, schließlich können die Netzbetreiber, dank Bundesnetzagentur, mit Garantierenditen von neun Prozent kalkulieren.
Schon bis zum Jahresende will Grundmann eine Gesellschaft gegründet haben, die das Geld einsammelt. Wie es dann weitergeht, ist noch unklar. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder wird eine eigene regionale Netzgesellschaft gegründet, welche die Stromleitungen baut und an der sich die Bürger beteiligen. Oder die Beteiligungsgesellschaft erwirbt direkt Anteile an Tennet und erhöht so das Eigenkapital des Stromnetzbetreibers.
Mehr Charme hat allerdings die erste Variante, da die Bürger sich wirklich an der Stromleitung auf ihrem eigenen Acker beteiligen könnten. Schließlich ist das Projekt ja deswegen in aller Munde, weil es die Akzeptanz der Bürger zum Stromleitungsausbau fördern soll. Noch ist die Arge Netz in Verhandlungen mit Tennet. Der Netzbetreiber teilt mit, dass er zurzeit die „rechtlichen und regulatorischen Fragen kläre“.
Grundmann kann es nicht schnell genug gehen. Schon im kommenden Jahr will er am liebsten den ersten Bürgernetzfonds auf den Weg gebracht haben. 2015 soll mit dem Bau der ersten Trasse begonnen werden. Zwei Jahre später könnte der erste Bürgerstrom fließen. Und vielleicht auch nach Niedersachsen. Dort interessieren sich inzwischen auch die ersten Kommunen für die Idee des Bürgernetzes.