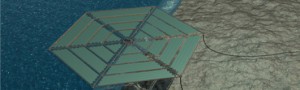Gibt es etwas Überflüssigeres als Verpackungen für Müllbeutel? (Man könnte gar eine geisteswissenschaftliche Abhandlung darüber verfassen, wie eine Müllsack-Verpackung sich selbst die eigene Nachfrage schafft, aber das nur am Rande.) Auf jeden Fall muss sich der US-Designer Aaron Mickelson diese Frage oft gestellt haben, als er an seiner Studienarbeit saß. Jedes Jahr fallen allein in Deutschland mehr als 15 Millionen Tonnen Verpackungsmüll an, in den USA sind es sogar 76 Millinen Tonnen im Jahr, so die Umweltbehörde EPA.
Der Verpackungswahn belastet die Umwelt, er kostet kostbare Energie für Produktion und Beseitigung – und ist vor allem ein Ärgernis. Ich erwähne hier nur am Rande die in Hartplastik eingeschweißten Zahnbürsten oder smartphones, die in Kartons daherkommen, die mindestens drei Mal so groß sind wie das eigentliche Produkt.
Mickelson hat sich ingesamt fünf Produkte vorgenommen, deren Verpackung er verschwinden lassen will, daher heißt seine Homepage auch http://disappearingpackage.com. Ein Beispiel sind etwa Waschmittel-Tabs, die Mickelsen in wasserlöslicher Plastik verpackt und die inklusive Verpackung dann in der Waschmaschine landen und sich aufläsen. Das erspart lästige Waschmittelkanister oder Pulverpakete.
Ein anderes Beispiel ist ein Stück Nivea Seife. Üblicherweise sind gerade teurere Seifen ja noch einmal extra in einem Pappkarton verpackt. Mickelsen hat sich nun auf die Suche nach wasserlöslichem Papier gemacht und das Seifenstück darin eingewickelt. Wäscht man die Hände unter´m Wasserhahn mit der Seife, löst sich das Papier mit auf.
Nun könnte man natürlich sagen: so ein Quatsch. Denn natürlich machen Verpackungen auch einen Sinn, weil sie eben schützen (Auf den Seiten von Wired diskutieren die Kommentatoren etwa, welchen Sinn gerade bei Seifen und Waschmitteln Verpackungen machen, die wasserlöslich sind). Aber Mickelsen will eine Debatte anstoßen. Welche Verpackungen brauchen wir eigentlich wirklich? Und welche sind einfach nur überflüssig – und oft ja leider noch nicht einmal dann wenigstens schön.