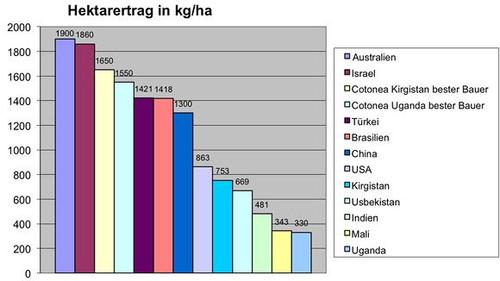Okay, manche Amerikaner lieben es wirklich schrill.
Ich sage nur: „Solar FREAKIN‘ Roadways“ und empfehle die ersten Minuten dieses Videos:
[youtube http://www.youtube.com/watch?v=qlTA3rnpgzU&w=580&h=315]
Hinter Solar Roadways steckt ein kleines Start-up aus Idaho, das mal eben die Straßen revolutionieren will. Es baut kleine, sechseckige Solarpanelen unter extra hartem Spezialglas, das sogar das Gewicht von LKW aushalten soll.
Die Idee: Statt Straßen aus Beton zu bauen, wollen Scott und Julie Brusaw Solarpanele verlegen. Diese produzieren Ökostrom (wenn alle Straßen in den USA mit Solarpanelen gebaut würden, ließe sich dreimal so viel Strom produzieren wie die USA gerade verbrauchen, will Scott Brusaw überschlagen haben). Außerdem sollen die Straßen auch noch sicherer sein, weil sie beheizt und mit LED-Leuchten ausgestattet sind. So sollen keine Unfälle mehr bei Glatteis oder mit Tieren passieren. In dem Straßenpaket ist zugleich auch noch ein Kanal für Datenkabel und ein Abwassersystem integriert. Die Brusaws sprechen von smarten Straßen.
Seit Ende April präsentiert das Paar auf der Crowdfunding-Plattform Indiegogo seine Idee. Eine Million US-Dollar wollen die beiden von Investoren einsammeln, um aus dem Prototypen-Stadium herauszukommen. Und die Crowd? Ist komplett fasziniert und hat bereits mehr als 1,8 Millionen Dollar spendiert (vielleicht lag das auch daran, dass es für eine Spende von 100 US-Dollar eine selbstgebastelte Lampe aus Solarzellen-Bruchstücken aus der Produktion gab). Solar Roadways ist damit die vierterfolgreichste Kampagne auf Indiegogo. Wegen des Erfolgs haben die Brusaws das Projekt auf der Plattform jetzt verlängert.
Was mir an der Idee gefällt, ist der Gedanke, dass wir wirklich noch mehr aus Straßen rausholen können. Der niederländischen Designer Dan Rosegaard experimentiert ja auch gerade mit schlauen Straßenmarkierungen. Das Konzept der Brusaws geht noch einen Schritt weiter, hier geht es nicht nur um Markierungen, sondern in den Solarpanelen sind eben auch gleich Mikroprozessoren verarbeitet.
Was leider nicht wirklich klar wird: Wie viel kostet denn nun eines dieser sechseckigen Solarpanele? Sicherlich ist es noch weit davon entfernt, sich in irgendeiner Weise zu rechnen. Und ergibt die Idee überhaupt in der Gesamtbilanz Sinn? Die Solarzelle muss ja erst einmal die Energie produzieren, die für ihre Beheizung und für die Mikroprozessoren gebraucht wird. Und dass sich jetzt Parkplätze anbieten als Installationsorte, auf denen ja am Ende Autos stehen und so die Solarzelle beschatten, ist auch nicht sofort überzeugend.
Kaum überraschend, dass die Community im Netz die Solar Roadways kontrovers diskutiert. „Why the Solar Roadways Project on Indiegogo is Actually Really Silly„, ist da noch ganz freundlich formuliert.
Hier übrigens ergänzend – Danke an die Kommentatoren unter diesem Blog – das Video der Kritiker: U.a. Wie bremst man überhaupt auf dem Belag?
[youtube http://www.youtube.com/watch?v=H901KdXgHs4&w=580&h=315]