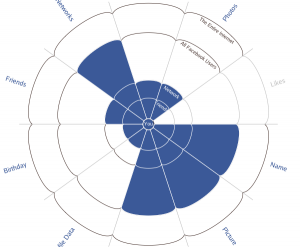Und ich dachte immer, Gewerkschaften sollen die Arbeitnehmer vertreten, nicht die Arbeitgeber. Was sich durch dieses Internet alles ändert… Doch von vorn. iRights.info hat einen Gesetzentwurf veröffentlicht, in dem deutsche Verlage mal so aufgeschrieben haben, wie sie sich ein Leistungsschutzrecht vorstellen – und die Gewerkschaften Deutscher Journalistenverband (DJV) und ver.di machen mehr oder weniger mit.
Was genau das Leistungsschutzrecht ist, ist nicht so leicht zu erklären. Doch im Kern geht es darum, dass Verlage eine neue Erlösquelle suchen und – wenn ich den Entwurf richtig verstehe – nicht mehr mit ihren Autoren teilen wollen. Bislang sammelt die Verwertungsgesellschaft Wort im ganzen Land Geld ein bei all jenen, die Urheberrechte nutzen. Wer also beispielsweise einen Text kopiert, zahlt dafür eine Abgabe an den Urheber. Kalkuliert wird die als Pauschale auf entsprechende Geräte wie Computer und Kopierer und ausgeschüttet wird das Geld an Autoren und Verleger. Für Autoren ist das ein kleines aber wichtiges Zubrot, treten sie doch ihre Verwertungsrechte inzwischen regelmäßig fast zur Gänze an Verlage ab – wofür sie Honorare erhalten, aber die waren auch schon mal besser.
Die Verlage nun wollen eine neue Verwertungsgesellschaft gründen und Geld sammeln für ihre eigenständige Leistung. Die Leistung besteht laut Gesetzentwurf in der Produktion:
Presseverleger ist derjenige, der die wirtschaftliche und organisatorische Leistung erbringt, um das Presseerzeugnis herzustellen.
Gesammelt werden soll das Geld genau wie das für die Urheber, per Abgabe auf Geräte, die zur Verfielfältigung dienen. Ob als Zusatzgebühr zu der bisherigen, oder als Teil dieser, sagt der Entwurf nicht. Nur eines ist klar: Teilen wollen die Verleger das Geld nicht mit denen, die ihnen die Produkte mit Inhalt füllen. Und die bisherige Urheberabgabe wird dadurch sicher auch nicht höher.
Aber das nur am Rande, denn eigentlich ist das ganze Gesetz fürchterlicher Murks. Zum Beispiel aus diesem von iRights.info angeführten Grund:
Wenn den Verlagen ein Recht gewährt wird, das den Urheberrechten sozusagen übergestülpt wird, wären Zweitverwertungen kaum noch möglich. Der Journalist bräuchte immer die Erlaubnis des Verlages, dem er seinen Beitrag zuerst überlassen hat, weil er stets in das Leistungsschutzrecht dieses Verlags eingreifen würde, wenn er seinen eigenen Artikel nutzt oder Rechte daran einem Dritten überträgt.
Oder aus diesem:
Wenn – wie von den Verlegern gefordert – sich das Leistungsschutzrecht auf kleinste (wie klein, wird nicht definiert) Teile ihrer Presseerzeugnisse erstreckt, wird damit die Sprache an sich monopolisiert. Die Schlagzeile (vom gestrigen Tage) „Hans im Glück“ würde dann etwa Spiegel Online gehören. Jeder, der das auch schreiben will, muss vorher mit der Verwertungsgesellschaft einen Vertrag schließen und Geld bezahlen. Aber hat diese Formulierung nicht vorher schon mal jemand genutzt? Muss dann Spiegel Online einen Vertrag schließen?
Oder diesem, der besagt, dass allein schon das Lesen eines vom Verlag frei ins Netz gestellten Textes am Bildschirm Geld kosten müsste:
Hiermit würde allerdings der Vervielfältigungsbegriff des Urheberrechts – im Übrigen unabhängig davon, ob es sich um gewerbliche oder private Nutzungen handelt – auf bloße Darstellungen am Bildschirm ausgeweitet – und damit gleichzeitig die zwingende europäische Vorgabe ausgehebelt, nach der flüchtige Vervielfältigungen im Cache oder Arbeitsspeicher von Rechten frei gestellt werden sollen (in Deutschland umgesetzt in Paragraf 44a UrhG).
Fazit:
Würde der Gesetzgeber diesen Forderungen Folge leisten, würde das unweigerlich zu einer nie da gewesenen Rechtsverwirrung führen und die Berichterstattung und Informationsvermittlung sowie -beschaffung in einer Weise beeinträchtigen, die bislang nur in Ansätzen absehbar ist.
Nachtrag: Hier eine hübsche Antwort aus dem Netz darauf. Mit Dank an die Opalkatze.