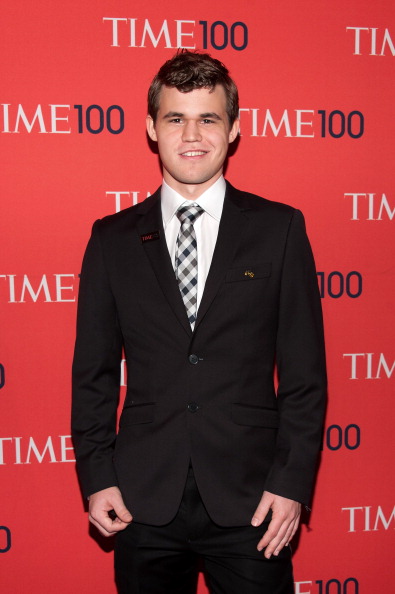ZEIT ONLINE: Herr Bastian, vor wenigen Monaten musste der Schachsport um Fördermittel des Bundes, ja um seine Anerkennung als Sportart kämpfen. Darüber wurde breit debattiert, auch bei uns (hier und hier). Aber ganz praktisch gesprochen: Was macht es für einen Durchschnittsspieler für einen Unterschied, ob es etwas mehr oder weniger Fördermittel gibt?
Herbert Bastian: Das ist eine etwas egoistische Haltung. So wird man in der Konkurrenz zu anderen Sportarten nicht bestehen können. Die Diskussion um die Fördermittel war eine rein formal-juristische um die Formulierung der Förderrichtlinien. Es ist nicht so, dass jemand das Schach plötzlich nicht mehr fördern wollte, ganz im Gegenteil: Schach hat in der Politik einen sehr guten Rückhalt.

ZEIT ONLINE: Aber was hätte sich geändert, wenn diese 130.000 Euro pro Jahr wirklich entfallen wären?
Bastian: Im Extremfall hätte man das komplette Leistungssportpersonal entlassen können, dann hätten wir keine Trainer mehr. Oder wir hätten die Beiträge erhöhen müssen. Wenn die Mitglieder bereit gewesen wären, einen bis zwei Euro im Jahr mehr zu zahlen, dann hätten wir uns diese Diskussion sparen können. Aber man kann sich leicht vorstellen, was passiert wäre, wenn wir das vorgeschlagen hätten.
ZEIT ONLINE: Und zwar?
Bastian: Die Landesverbände hätten sich gegen die Beitragserhöhung gestemmt und wir hätten doch Personal entlassen müssen. Und die vielen Ehrenamtlichen hätten dadurch noch mehr Arbeit als vorher. Es kann nicht sein, dass der Staat sich dermaßen aus der Verantwortung zurückziehen will wegen einer unglücklichen Formulierung („eigenmotorische Aktivität des Sportlers“, Anm. des Autors). Es ist ja nicht so, dass man Schach generell nicht fördern will, oder nicht als etwas Sinnvolles ansieht, es stand nur diese Formulierung im Wege. Deshalb haben wir auch erbittert gekämpft.
ZEIT ONLINE: Es hat sich gelohnt?
Bastian: Es steht eine Einigung bevor, nach der es eine gewisse Reduzierung der Fördermittel geben wird. Die Richtlinien für förderungswürdige Sportarten werden im Dezember überarbeitet und anstelle der notwendigen eigenmotorischen Aktivität wird dort eine andere Formulierung stehen, die auch das Schach wieder diskussionslos mit einschließen wird.
ZEIT ONLINE: Ist auch eine Finanzierung jenseits der nächsten vier Jahre gesichert, oder ist die kommende Einigung ein letzter Akt der Kulanz seitens der Politik?
Bastian: Das glaube ich nicht. Wie gesagt, die Unterstützung der Politik ist sehr gut und es wird durchaus wahrgenommen, welche positiven Effekte das Schachspielen auf junge Leute ausübt.
ZEIT ONLINE: Beim Fide-Kongress am Rande der Schacholympiade in Tromsø wurden Sie zu einem der Vizepräsidenten der Fide gewählt. Versprechen Sie sich durch ihr neues Amt auch Vorteile für den Deutschen Schachbund?
Bastian: Zuallererst hoffe ich, dass sich das Verhältnis zur Fide etwas verbessert. Da ist einiges zu tun, zum Beispiel wurden bei den letzten zwei Olympiaden keine deutschen Schiedsrichter eingesetzt, als Strafe, weil der Deutsche Schachbund zuvor zusammen mit anderen Landesverbänden die Fide verklagt hatte. Solche Streitigkeiten müssen endlich ein Ende nehmen. Ein möglicher Vorteil für den Schachbund aus der engeren Zusammenarbeit könnte zum Beispiel ein Spitzenturnier der Fide sein, das in Deutschland stattfinden könnte. Auch für das Senioren- und das Frauenschach erhoffe ich mir starke Impulse.
ZEIT ONLINE: Ihre Wahl war für die Öffentlichkeit eine ziemliche Überraschung. War Ihre Nominierung geplant oder spontan?
Bastian: Solche Wahlen laufen nie unvorbereitet. Allerdings habe ich die Diskussion in Deutschland bewusst vermieden, weil es ja auch Diskussionen darüber gab, ob bei den Fide-Präsidentschaftswahlen der Herausforderer Gari Kasparow unterstützt werden soll oder nicht oder ob man eventuell sogar den alten Präsidenten Iljumschinow unterstützt. Wir haben uns entschieden, neutral zu bleiben, das soll auch weiter so sein. Deutschland ist ein starker und selbstbewusster Verband und wird sich auch weiter keinem Lager zuordnen oder instrumentalisieren lassen.
ZEIT ONLINE: Sie finden es nicht schade, dass es Kasparow nicht geschafft hat?
Bastian: Geld ist sicherlich auf beiden Seiten in Unmengen geflossen. Aber die Mehrheit für Iljumschinow ist nicht nur dadurch zustande gekommen. Kasparow gilt nicht als Teamplayer und er hat im Wahlkampf einen klaren strategischen Fehler gemacht: Er hat seine Opposition gegen Putin mit dem Engagement in der Fide verknüpft. Das konnte nicht gutgehen. Die russische Föderation ist seit jeher die stärkste und die wichtigste in der Fide und es ist unklug, wenn man diese gegen sich aufbringt. Der Präsident der Fide muss ein Diplomat sein und mit allen 181 Mitgliedsnationen klarkommen. Und Kasparow polarisiert zu stark.
ZEIT ONLINE: Aber ist Iljumschinow nicht schon aus dem Grunde untragbar, dass sich, solange er an der Macht ist, nichts daran ändern wird, dass jedes Land bei den Wahlen genau eine Stimme hat?
Bastian: Ich glaube nicht, dass er nichts ändern will. Das ist im Übrigen einer der Punkte, warum ich mich engagiere. Ich werde versuchen auszuloten, was man ändern könnte. Diese Regel ist in der Tat unsäglich und sie muss infrage gestellt werden. Aber es geht nur, wenn man Änderungen im Rahmen der geltenden Gesetze beschließt, also mit Einverständnis einer Mehrheit der Föderationen.
ZEIT ONLINE: Kein Präsident vor Iljumschinow hat diese Regel so skrupellos ausgenutzt. Warum sollte sich irgendetwas ändern?
Bastian: Der Pessimismus ist für mich durchaus nachvollziehbar, aber man muss sich trotzdem nicht in sein Schicksal ergeben. Wenn man etwas verändern will, muss man anfangen und nach Möglichkeiten suchen. Dass es nicht einfach sein wird, ist klar, aber so eine Materialschlacht wie bei diesem Wahlkampf war mit Sicherheit für keine der Seiten gut. Was da an Geld verpulvert worden ist, hätte man besser sinnvoll für Schach eingesetzt.
ZEIT ONLINE: So ist das Geld überall auf der Welt bei irgendwelchen Schachfunktionären versickert.
Bastian: An sich macht die Fide eine kluge Politik, weil sie Projekte bezuschusst. Aber es ist klar, dass diese Unterstützungen auch mit dem Wahlkampf zusammenhängen. Nur es darf auf keinen Fall passieren, dass man an Privatpersonen Geld verteilt im Rahmen des Wahlkampfs.
ZEIT ONLINE: Kann man sagen, dass Sie auch angetreten sind, um Iljumschinow zu zähmen?
Bastian: Mit so einer Formulierung würde ich mich selbst überschätzen. Aber ich sehe Iljumschinow gar nicht so negativ, wie er in der Presse dargestellt wird.
ZEIT ONLINE: Was ist Iljumschinow denn für ein Mensch? Wenige kennen ihn persönlich. In den Medien steht er nicht besonders positiv da.
Bastian: Ich empfinde ihn als sehr angenehm, als einen Menschen der sehr freundlich ist, immer lächelt und seinen Gegnern grundsätzlich immer die Hand ausstreckt. Wer in der Fide aber das Sagen hat, ist Georgios Makropoulos. Iljumschinow hat das Geld. Worüber man sich auch im Klaren sein muss: Iljumschinow ist ein Sonderbotschafter von Putin. Seine Besuche bei Gaddafi und Assad waren politische Missionen und dass das Schach dabei mit auf den Tisch gekommen ist, war sehr unglücklich. Diese Auftritte sind ihm sehr negativ angelastet worden, aber man muss auch bedenken, was die Fide in den vergangenen Jahren Positives geleistet hat. Im Grunde ist sie ein hervorragend funktionierender Apparat mit gesicherten Finanzen und kompetenten Mitarbeitern, wenn auch teils etwas überehrgeizigen Zielen. Iljumschinow und die Fide sind nicht das Gleiche.
ZEIT ONLINE: Schach wurde in Tromsø auch gespielt. Wie beurteilen Sie das Abschneiden der beiden deutschen Mannschaften?
Bastian: Die Frauen haben sehr gut gespielt. Leider hat es noch nicht für eine Medaille gereicht, aber jetzt haben sie endlich gemerkt, dass sie noch mehr können und werden hoffentlich in Zukunft weiter an Selbstbewusstsein gewinnen. Die Männer haben nur in den letzten beiden Runden Konditionsprobleme gehabt, bis dahin konnte man sogar auch auf eine Medaille hoffen. Deswegen bin ich mit dem Abschneiden der Männer nicht so unzufrieden, wie es Platz 30 vielleicht vermuten lässt. Wir brauchen aber noch mehr Spieler, die in der Nationalmannschaft spielen können. Aktuell sind wir zu sehr auf die Form einiger weniger angewiesen. Es wird sich bald zeigen, ob die Prinzen Dennis Wagner und Matthias Blübaum schon so weit sind, gegen Weltklasseleute antreten zu können.
ZEIT ONLINE: Der Schachbund und seine Sponsoren lassen sich das Schachjahr der beiden Jugendspieler einiges kosten. Die Spieler, die zurzeit in der deutschen Mannschaft spielen, sind aber auch ohne großartige Fördermaßnahmen dahin gekommen, wo sie jetzt stehen. Wie erklären Sie diese Schachjahr-Ausgaben dem normalen Beitragszahler?
Bastian: Vieles sind sowieso zweckgebundene Sponsorengelder. Es werden für das Schachjahr nicht mehr Gelder aus den Beiträgen benutzt als sonst, diese werden nur anders verteilt.
ZEIT ONLINE: Aber kommt das Geld auch irgendwann zurück?
Bastian: Wir müssen in Deutschland langfristig sowieso das komplette Ausbildungssystem von jungen Spielern umstellen. Es geht nicht nur um den Einsatz von mehr Geld, es muss sich auch strukturell einiges verändern. Wir müssen viel mehr Menschen an der Basis motivieren, dass sie die Talente früher erkennen und schneller zu einer hohen Spielstärke führen, dass wir schneller herausfinden können, wie konkurrenzfähig wir auch international sind. Wenn man eine Sportorganisation ist, muss man das Bestreben haben, in die Weltspitze zu kommen, sonst macht man sich überflüssig. Aber da haben wir noch lange nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft. Die Investition in Spitzenspieler zahlt sich immer aus, weil sie Sogwirkungen erzeugen.
ZEIT ONLINE: Für viele, die es versucht haben, hat sich der Weg Richtung Weltelite aber nicht als der richtige erwiesen.
Bastian: Das stimmt. Aber man lebt ja länger als ein paar Jahre. Es ist durchaus denkbar, dass eine Entwicklung wie in anderen Sportarten einsetzt: Dass unsere besten Talente ein paar Jahre Profischach machen und anschließend, vielleicht gerade mit Hilfe des Schachverbandes, wieder in den Jobmarkt eingegliedert werden. Viele Arbeitgeber schätzen hochqualifizierte Schachspieler sehr.