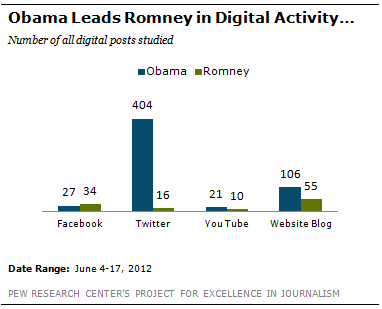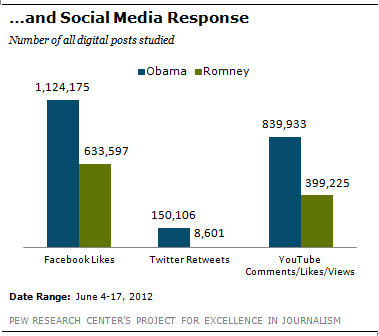In der Regel scheren sich amerikanische Präsidentschaftskandidaten nicht um das Programm ihrer Partei. Oft haben sie dieses nicht einmal gelesen, und es ist ihnen überdies egal, was dort steht, denn es zählt sowieso nicht.
Parteiprogramme haben, historisch gesehen, meist nur einen Zweck : Dort können, dürfen und sollen sich die extremen politischen Kräfte austoben. Dort können sie niederschreiben, was ihnen in den Sinn kommt. Die Programme dienen in erster Linie als Placebo für Außenseiter.
Das ist diesmal bei den Republikanern anders. Denn die Partei ist unter dem Einfluss der Tea-Party-Bewegung und religiöser Eiferer insgesamt so weit nach rechts gerückt, dass das Programm nicht nur Spiegelbild der republikanischen Partei ist, sondern ebenso des Präsidentschaftskandidaten Mitt Romney und dessen Vize Paul Ryan. Extreme Meinungen geben bei den Republikanern den Ton an und bestimmen die generelle Ausrichtung der Partei, sie sind inzwischen, um es mit einem gängigen englischen Wort zu sagen: Mainstream.
Es liegt inzwischen ein Entwurf eines Programms vor, der auf dem Parteitag in der kommenden Woche verabschiedet werden soll. Auch das geschieht meist sang- und klanglos. Doch jetzt richten sich alle Augen auf dieses Papier und die Diskussion darüber. Denn das Programm zielt mitten in die höchst sensible und hochpolitische Debatte um das Recht auf Abtreibung. Die Mehrheit der Amerikaner will dieses Recht erhalten, die Mehrheit der Frauen sowieso.
Verheerende Ansichten eines Hinterbänklers
Zu verdanken haben Romney & Co. diese höchst unwillkommene Diskussion einem republikanischen Politiker aus dem US-Bundesstaat Missouri, der sich um einen Senatorensitz im Kongress in Washington bewirbt. Dieser Mann sagte jüngst in einem Interview, Opfer von „richtigen“ Vergewaltigungen würden in der Regel nicht schwanger.
Üblicherweise hätte diese verheerende Ansicht eines Hinterbänklers der Politik keine nationale Aufmerksamkeit erregt. Doch diesmal hat sie zwischen Atlantik und Pazifik einen gewaltigen Proteststurm ausgelöst. Nicht nur, weil Wahlkampf ist und die Demokraten dankbar jedes Thema aufnehmen, um von der Debatte über die marode Wirtschaftslage abzulenken.
Nein, der tumbe Senatorenkandidat aus Missouri lenkt die Aufmerksamkeit mit voller Kraft auf das Parteiprogramm und auf den Präsidentschaftskandidaten und seinen Vize. Auf einmal möchte man wissen, was denn die nach rechts gerückten Republikaner in dieser Sache denken. Und wessen Geistes Kind ihre Frontmänner sind.
Plötzlich kommt zum Vorschein, dass Mitt Romney wie auch das Parteiprogramm für ein verfassungsrechtliches Verbot von Abtreibungen plädiert. Und dass sein Vize Paul Ryan ebenso wie das Parteiprogramm noch weit radikalere, um nicht zu sagen: extremere Ansichten vertritt. Er fordert – wie das Programm – ein absolutes Abtreibungsverbot, selbst im Fall von Inzest und Vergewaltigung. Mitt Romney ist da zwar anderer Ansicht und will diese Ausnahmen. Aber jetzt hat er eine Debatte am Hals, die wie ein Mühlstein um seinen Hals hängen wird.
Parteiprogramm enthält weitere extreme Forderungen
Zudem: Jetzt lesen viele das an sich überflüssige und meist verdrängte Parteiprogramm. Bei der Lektüre stoßen sie dabei auf weitere extreme Forderungen. Die republikanische Partei will homosexuelle Ehen verbieten und in der Verfassung festschreiben, dass die Ehe nur zwischen Mann und Frau geschlossen werden darf.
Aufmerksamkeit erregen auch die harschen Formulierungen zum Thema Einwanderung. Die republikanische Partei will eine Mauer beziehungsweise einen Zaun entlang der gesamten amerikanisch-mexikanischen Grenze errichten, sie will illegale Einwanderer des Landes verweisen und selbst deren Kindern kein bisschen Hilfe zukommen lassen.
In Wahlkampfzeiten, da beide Parteien um die Stimmen von Amerikanern lateinamerikanischer Herkunft buhlen, schrecken diese Passagen ab. Auf dem Parteitag in Tampa, Florida, wird man in der kommenden Woche sehen, ob Mitt Romney den Mut und die Kraft besitzt, sich von seiner Partei weg in die Mitte zu bewegen. Oder ob er seinem Ruf gerecht wird, ein Zauderer und ein Wendehals zu sein.