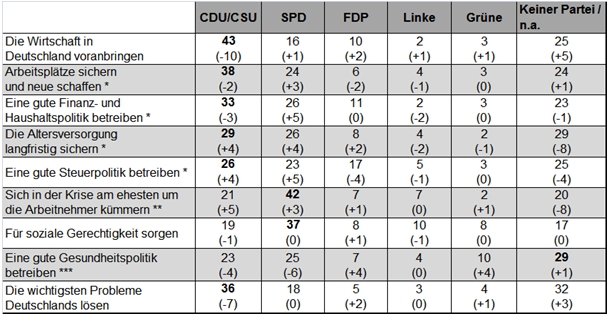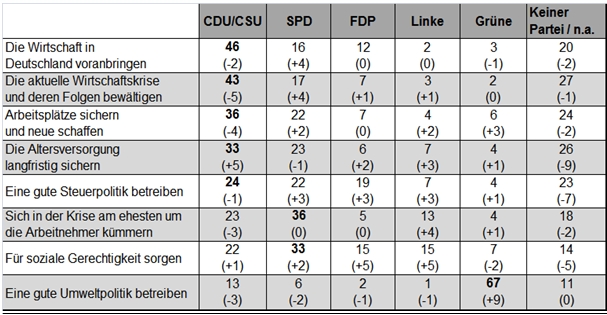Nordrhein-Westfalen hat gewählt, eine klare Aussage getroffen hat es aber nicht. Mit Ausnahme einer großen Koalition ist kein Zwei-Parteien-Bündnis möglich und sämtliche Dreierkonstellationen wurden vor der Wahl entweder als nicht realisierbar befunden (Rot-Rot-Grün) oder definitiv ausgeschlossen (Ampel und Jamaika). Dies lässt die Parteien in einer Patt-Situation zurück und es scheint, als ob diejenige, die den ersten Zug wagt, das Spiel verlieren würde.
Nordrhein-Westfalen hat gewählt, eine klare Aussage getroffen hat es aber nicht. Mit Ausnahme einer großen Koalition ist kein Zwei-Parteien-Bündnis möglich und sämtliche Dreierkonstellationen wurden vor der Wahl entweder als nicht realisierbar befunden (Rot-Rot-Grün) oder definitiv ausgeschlossen (Ampel und Jamaika). Dies lässt die Parteien in einer Patt-Situation zurück und es scheint, als ob diejenige, die den ersten Zug wagt, das Spiel verlieren würde.
Doch was landespolitisch sehr kompliziert und nicht minder heikel daherkommt, könnte für Frau Merkel aus bundespolitischer Sicht ein Optimalzustand sein. Natürlich hat sie sich in den Wahlkampf einbringen müssen und natürlich wollte sie einen Absturz ihrer Partei in die Opposition verhindern. Eine Fortführung des schwarz-gelben Bündnisses jedoch hätte sie andererseits unter erheblichen Zugzwang gesetzt. Derzeit jedoch stehen viele Zeichen auf große Koalition, sodass sich der Erhalt der Regierungsverantwortung in NRW mit der stärkeren Einbindung der SPD in der Bundespolitik paaren könnte, womit die Grundlage für breite Konsense in unpopulären Fragen geschaffen wäre. Zudem legt das Wahlergebnis auch noch nahe, dass die CDU durch ihren denkbar knappen Vorsprung vor der SPD in einer solchen Koalition weiterhin den Ministerpräsidenten stellen würde, dieser aber wohl nicht mehr Jürgen Rüttgers heißen würde, da sich die herben Verluste der Union auch mit seiner Person verbinden. Dem innerparteilichen Kontrahenten wäre somit der Boden für bundespolitische Ansprüche entzogen, zugleich könnte sich aber auch mit Hannelore Kraft keine Persönlichkeit der SPD als starke Ministerpräsidentin etablieren und ihrer Partei inmitten der schwierigen Identitätssuche ein prägendes Gesicht geben.
Eine große Koalition in NRW würde Deutschland bereits ein gutes halbes Jahr nach Antritt der schwarz-gelben Bundesregierung wieder zu dem machen, was es nach Ansicht der Wissenschaft schon immer war: ein Staat der großen Koalitionen. Nur selten konnten Regierungen auf Mehrheiten in Bundestag und Bundesrat bauen, zumeist waren also Kompromisslösungen und Abstimmungen über die Parteigrenzen hinweg sowie zwischen Bundes- und Länderebene nötig. Gerade in Krisenzeiten könnte dies nicht nur gut für die Bundeskanzlerin sein, der die moderierende Rolle liegt und die dafür zu Zeiten der Großen Koalition im Bund auch sehr geschätzt wurde. Sondern auch gut für Deutschland, das auf diese Weise Parteienstreits, symbolischer Politik etc. entgehen könnte. So gesehen hätte das Wählervotum in NRW in all seiner Unklarheit doch den politischen Willen vieler auf den Punkt gebracht.