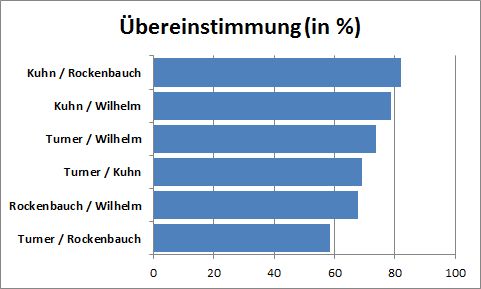Ja, uns Journalisten ermüdet der Streit bei den Piraten mittlerweile auch. Doch leider schafft die Partei es immer wieder, noch eine neue, dramatischere Eskalationsstufe im innerparteilichen Umgangston zu erklimmen. Und das sagt dann wiederum durchaus etwas über eine Partei aus, die in vier Landtagen sitzt und dieses Jahr in den Bundestag einziehen will. Deshalb wollen wir also auch das neueste Drama zumindest kurz dokumentieren.
Glaubt man Johannes Ponader, dem politischen Geschäftsführer der Piratenpartei, ist am gestrigen Mittwochabend folgendes passiert: Um 18 Uhr schickte Christopher Lauer, bekannter Pirat und Mitglied im Berliner Abgeordnetenhaus, eine bemerkenswerte SMS an ihn, Ponader:
„Lieber Johannes, wenn Du bis morgen 12:00 Uhr nicht zurückgetreten bist, knallt es ganz gewaltig. Ich seh mir nicht mehr länger schweigend und untätig an, wie Du meine Partei gegen die Wand fährst. Gruß, Christopher“
Wenn es diese Nachricht tatsächlich gab, ist sie eine unverhohlene Drohung. Ponader kam ihr offensichtlich nicht nach. Dafür postete er die vermeintliche SMS und die darauf folgende Kommunikation mit Lauer am heutigen Donnerstagmittag kurzerhand in einem Blog im Internet. Es endet mit Lauers Statement: „Alter, wie verstrahlt bist Du denn? Du merkst ja gar nichts mehr.“
Ponader schreibt dazu im Blog: „Ich bin mir bewusst, dass die Veröffentlichung einer ‚privaten‘ SMS eigentlich einen Vertrauensbruch darstellt, aber von Vertrauen kann bei dem Inhalt wohl keine Rede mehr sein.“ Den Eintrag verbreitete er über seinen Twitter-Account, dem über 10.000 Leute folgen.
Auf Anfrage von ZEIT ONLINE will Lauer die Echtheit der SMS weder bestätigen noch dementieren: „Ich kann Ihnen die Frage, ob ich diese SMS überhaupt geschrieben habe, nicht beantworten“, sagt er. Es gäbe zwei Möglichkeiten: „Entweder sie ist echt, dann ist es eine private Nachricht und hat in der Öffentlichkeit nichts verloren. Oder sie ist nicht echt und er hat sich das ausgedacht, dann ist es schon ein starkes Stück.“ Er habe gar keine Zeit für Personaldebatten, sondern bemühe sich um eine inhaltliche Neuaufstellung für die Bundestagswahl.
Bei Twitter reagierten andere Piraten entnervt auf das neuerliche Skandälchen. „Möchte Euch alle auf den stillen Stuhl verbannen. Bis zur #btw13. Mindestens.“ schreibt die Wirtschaftspolitikerin Laura Dornheim. Und der Pirat Jan Leutert twittert: „Treffen sich zwei Piraten mit Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Keine Pointe.“
Johannes Ponader selbst sagt zu Lauers Reaktion: „Das geht am Thema vorbei. Wenn jemand einen Rücktritt fordern will, soll er das auch öffentlich machen.“ Er habe die SMS veröffentlicht, „weil wir so die Chance auf Knall, Versöhnung und dann Neuanfang haben“. Es gehe ihm „nicht um eine Personaldebatte, sondern um eine Debatte über den innerparteilichen Umgangsstil“. Mit Lauer selbst habe er seit der SMS keinen Kontakt mehr gehabt.