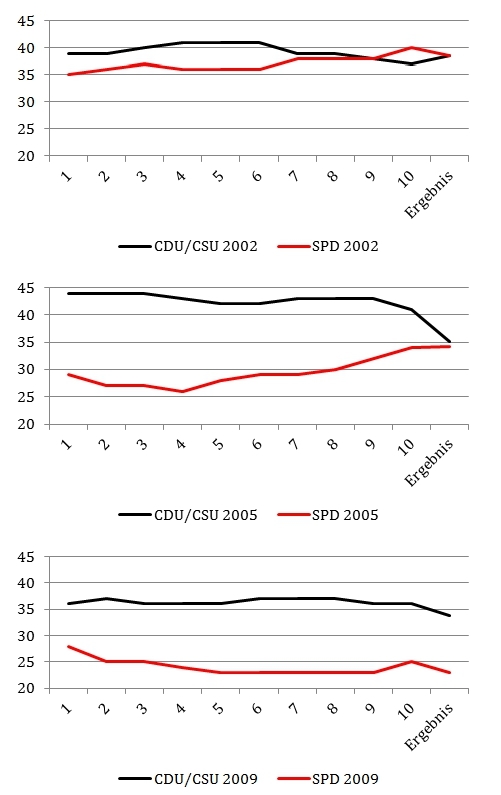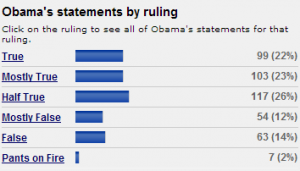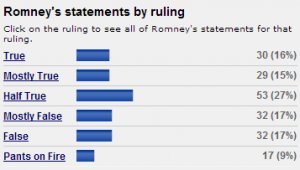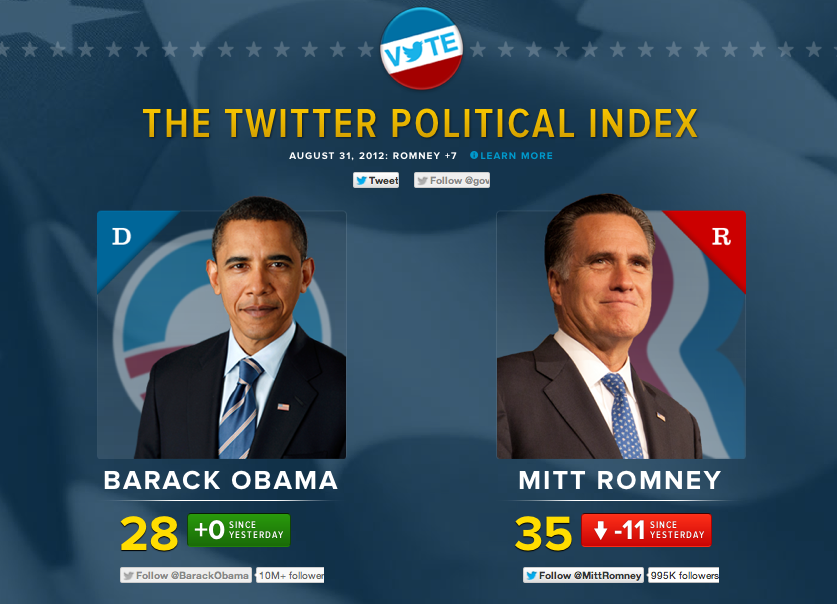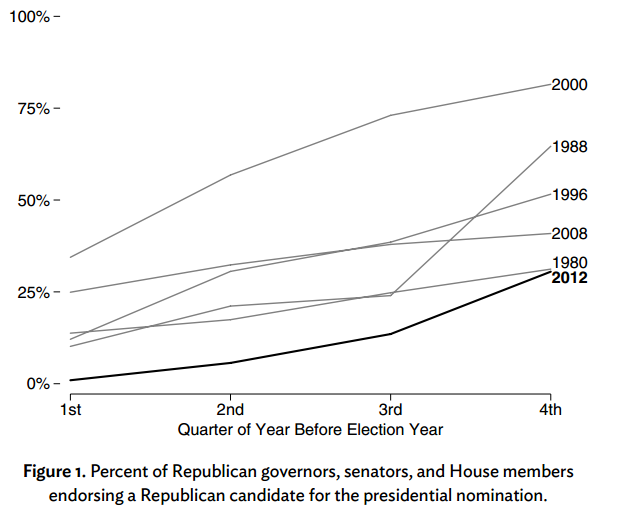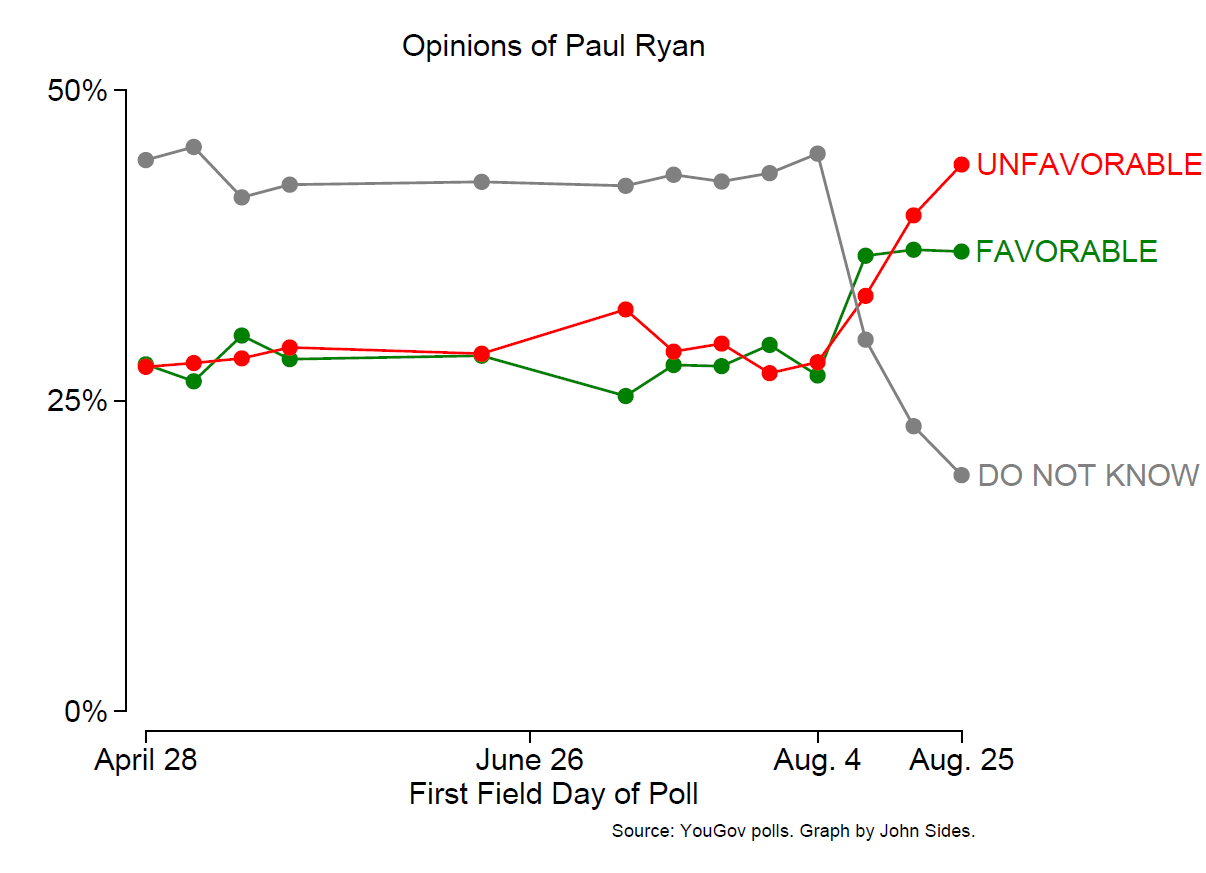Ein Blog-Stöckchen fliegt durch die deutschen Redaktionen. Es geht um die Bundestagswahl. Sechs Fragen, schnell zu beantworten – und dann zu Kollegen weiter werfen. Vor uns war es unter anderem bei der Stuttgarter Zeitung, Süddeutsche.de und beim Deutschlandfunk. Und beworfen haben uns unsere Verlagsbrüder und Straßen-Nachbarn vom Tagesspiegel. Danke auch. Man hat in so einer Vorwahl-Woche ja sonst nix zu tun.
Wir haben uns trotzdem die Zeit genommen – hier unsere Antworten.
Bester Beitrag
Wie verhalten sich die Anhänger der AfD im Internet? Ziemlich rüde, müssen wir leider konstatieren. Selten haben wir – in dieser Häufung – so feindselige Leserbriefe bekommen wie von den Euro-Kritikern. Betrachtet man das folgende tumblr, ahnt man, welche Rhetorik gemeint ist. Zu sehen sind Screenshots der hanebüchensten Facebook-Updates bekennender AfD-Sympathisanten: „AfD-Wähler stellen sich vor.“
http://afdwaehlerstellensichvor.tumblr.com/
Schön ist auch das Tumblr-Blog von @miinaaa: Fragen zu Wahlkampf, die mit animierten GIFs kombiniert werden. Beispiel: Wie reagiert Steinbrück auf freche Fragen? Die Antworten von Walter White, Homer Simpson und Meryl Streep hier:
http://regierungsgifs.tumblr.com/
Liebstes btw13-Video
Witzig und ziemlich erfolgreich ist dieses Wahl-Video der guten, alten IG Metall.
Ähnliche Motivation, nicht ganz so lustig, aber auch gut gemeint, dieser Wahlaufruf für junge Leute:
Noch was? Unsere anglophilen Kollegen schwören auf diesen kurzen Guide der BBC zur Bundestagswahl http://t.co/2J7JZejWvH
Partei mit der besten Social-Media-Kampagne
Eine richtig begeisternde So-Me-Kampagne haben wir in diesem Wahlkampf nicht registriert. Es gibt in mehreren Parteien immer wieder einzelne gute Ideen. Unterm Strich: Vielleicht doch die SPD? Trotz aller Häme über das gescheiterte peerblog und andere Missgriffe. Immerhin hatten die Genossen Schwarz-Gelb-Blog und Monty-Python-Video. Smart auch das sozialdemokratische Hashtag #diespdwars, das Unterstützer verwenden, um Attacken gegen die Partei zu ironisieren.
Schönstes Plakat
Und den gemalten Ströbele schaut man sich doch jedes Mal wieder an.
Hässlichstes Plakat
Spontan: FDP, Spitzenkandidat Rainer Brüderle. Die Geste, die Brille – so richtig vorteilhaft kommt er nicht rüber (by the way: auch beim TV-Spot mit dem Frühstücksei dachten wir kurz: ernst gemeint?)
Klar: Alles Rechtsradikale hat uns natürlich nicht gefallen. Und diesen ertrinkenden Euro fanden wir auch abstoßend.
Wem unbedingt folgen?
Wahlprognose
Wir haben redaktionsintern abgestimmt, wie viel Prozent die AfD bekommt. Das Ergebnis: Eine knappe Mehrheit traut der Partei 4 Prozent zu, viele glauben auch an ihren Einzug in den Bundestag, zwei Kollegen sehen sie gar bei 8 Prozent.
Und sonst? Na Angela Merkel, oder? Mit wem: Meinungsbild offen.
Als nächstes dürfen sich die Kollegen von Spiegel Online etwas ausdenken. Da, fangt das Stöckchen!
Von Till Schwarze, Juliane Leopold und Michael Schlieben