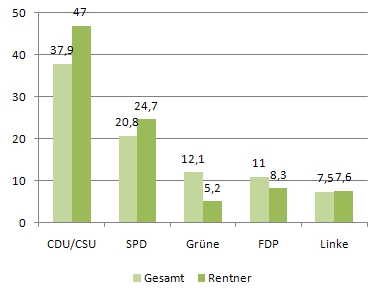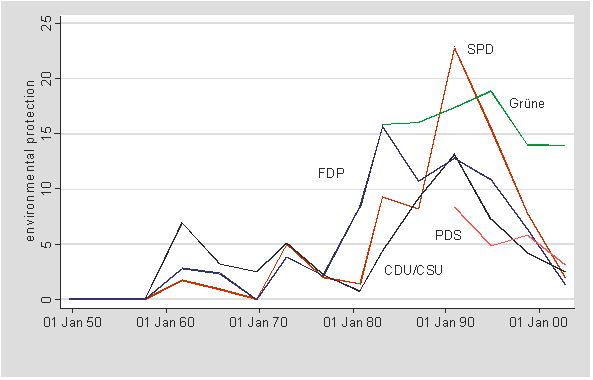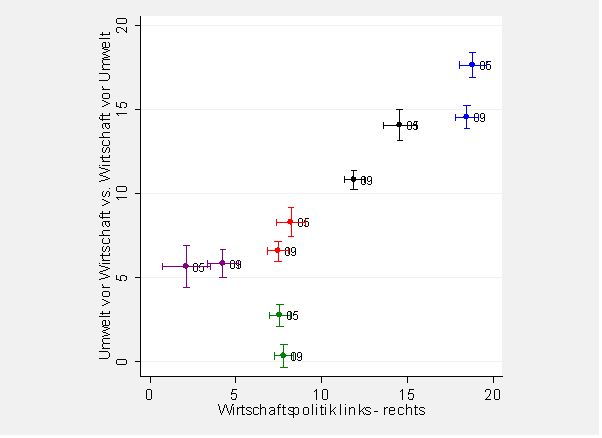Seit dem heutigen Tage ist Thomas Steg nicht mehr stellvertretender Regierungssprecher. In diesem Amt hat sich der SPD-Mann – auch beim Koalitionspartner – einigen Respekt verschafft, und umgekehrt steht auch er selbst der Bundeskanzlerin nach jahrelanger intensiver Zusammenarbeit positiv gegenüber. Dass er nun ins Zentrum des SPD-Wahlkampfes wechselt, mag da manchen wundern. Ist politisches Feingefühl wirklich eine Qualität, die sich mühelos von einer auf die andere Situation übertragen lässt?
Seit dem heutigen Tage ist Thomas Steg nicht mehr stellvertretender Regierungssprecher. In diesem Amt hat sich der SPD-Mann – auch beim Koalitionspartner – einigen Respekt verschafft, und umgekehrt steht auch er selbst der Bundeskanzlerin nach jahrelanger intensiver Zusammenarbeit positiv gegenüber. Dass er nun ins Zentrum des SPD-Wahlkampfes wechselt, mag da manchen wundern. Ist politisches Feingefühl wirklich eine Qualität, die sich mühelos von einer auf die andere Situation übertragen lässt?
In den USA – zweifellos das Mekka des modernen campaigning – hat man sich an solche fliegenden Wechsel mittlerweile gewöhnt. Dick Morris beispielsweise war für die Republikaner tätig, bevor er ins Clinton-Lager wechselte und einer der Strippenzieher der erfolgreichen Wiederwahl-Kampagne von 1996 wurde. Er galt als Experte für das Überzeugen von Unentschlossenen und Wechselwählern; sein Rezept war, den Demokraten Bill Clinton ein bisschen „republikanischer“ auftreten zu lassen. In diesem Fall ging das Kalkül des Clinton-Teams, sich ein bisschen Stallgeruch der Gegenseite zuzulegen, also voll auf. Und auch James Carville, wichtiger Berater während der ersten Clinton-Kampagne 1992, ist von der Universalität gewisser Wahlkampf-Lehren überzeugt. Er hat nach seinem Einsatz für Bill Clinton unter anderem Tony Blair und Ehud Barak beraten, der von ihm geprägte Ausdruck „It’s the economy, stupid“ fand weltweit in Wahlkämpfen Beachtung. Eine Gegenspielerin im US-Präsidentschaftswahlkampf von 1992, George H. Bushs Wahlkampfmanagerin Mary Matalin, hat Carville übrigens ein Jahr später geheiratet. Es scheint also allen parteipolitischen Gegensätzen zum Trotz viele Gemeinsamkeiten zwischen unterschiedlichen Wahlkämpfen und auch zwischen den Wahlkämpfern zu geben.
Die deutsche Wahlkampfforschung wendet dagegen ein, dass enge und produktive Zusammenarbeit auch auf langfristigen Werten wie etwa der Parteibindung basiert. Schließlich haben Parteien in Deutschland einen höheren Stellenwert und eine prägendere Funktion im politischen System, als es in den USA der Fall ist, wo Seiteneinstiege von unpolitischen Personen in politische Ämter an der Tagesordnung sind. Auch die deutschen Wahlkampfberater selbst raten mehrheitlich von schnellen Wechseln ab und betonen, dass gewachsenes persönliches Vertrauen die Grundsubstanz guter Zusammenarbeit ist.
Die Skepsis gegenüber sprunghaften Beratern scheint begründet. Dick Morris jedenfalls arbeitet inzwischen wieder für die Republikaner, nachdem er sich mit Hillary Clinton überworfen hat, und mancher fragt sich nun, ob er je ein echter Anhänger der Demokratischen Partei war. Thomas Steg hingegen scheint in der SPD verwurzelt zu sein. Aber wer weiß schon, was Angela Merkel eines Tages noch mit ihm vorhat…