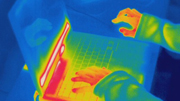Nun gut, es ist nicht gerade ein Rekordergebnis. Gut 1000 Bürgerinnen und Bürger nahmen am ersten Bürgerdialog der Kanzlerin im Internet teil. Angesichts von lautstarker Werbung im Kino und auf Youtube, war die Mitmachquote des zweimonatigen Dialogs von September bis Mitte November mager.
„Wohin soll die Nation in puncto Nachhaltigkeit steuern?“ lautete das Thema. 27.000 Besuche verzeichnete der Seitenzähler. Erreicht wurde vor allem die eloquente, gebildete Schicht ab 36 Jahren, die sich selbstbewusst zu Wort meldete und über grüne Wirtschaft und grünen Lebensstil diskutierte. Top-Thema mit über 260 Beiträgen war der Klimaschutz, das bedeutsame Thema Wasser tröpfelte mit 70 Beiträgen eher dahin. Das lag allerdings auch daran, dass die Seite unübersichtlich war und viele Themen nicht besonders prominent präsentiert wurden.
Das größte Manko ist allerdings: Niemand weiß so genau, was jetzt mit dem Beitrag der Bürger passiert. Es heißt, alles werde an die zuständigen Ministerien „weitergeleitet“ und „fließe“ in einen Fortschrittsbericht ein. Ungeordnet? Ohne klare Voten herauszuarbeiten?
Das klingt eben doch genau so autistisch, wie viele Bürger die Regierung empfinden. Zumindest bleibt der Eindruck, das Angela Merkel das Wissen der Bürger nicht für wirklich wichtig hält. Zweifellos müssen offene Dialoge, wie sie sie führen will, dringend erprobt werden, wenn die zerrüttete Beziehung zwischen Bürgern und Politik gekittet werden soll. Wer aber mehr Bürger für E-Konsultationen hinter dem Ofen hervorlocken will, muss in Zukunft ein attraktiveres Angebot machen. Schön gewesen wäre beispielsweise die Aussicht an einzelnen Kapiteln mit schreiben zu können.
Leider blieb die Kanzlerin auch noch stumm. Dabei hatte sie sich zum Auftakt noch tapfer via Podcast zu Wort gemeldet. So ein Online-Dialog ist aber eben keine Einbahnstraße. Besser machte das Bundesinnenminister Thomas de Maizière. Am Ende seiner E-Konsultation zur Netzpolitik stellte er Anfang Dezember eine Videobotschaft ein. Das wirkte noch ungelenk, zeigt aber, dass er die Stimmen von außen ernst nimmt.
Feedback – das könnte Angela Merkel doch auch mal versuchen. Eigentlich gleicht es politischem Harakiri, erst einen Dialog anzubieten und dann nur die Achseln zu zucken.