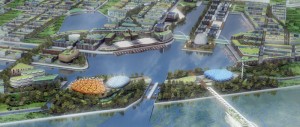Es kann sicherlich nicht am Ort gelegen haben, lieber Herr Röttgen, oder? Horsens in Dänemark sieht doch ganz plauschig aus, ein Hafenstädtchen in Ostjütland, das Meer vor der Nase.
Heute sind dort die Umweltminister Europas zu einem informellen Treffen zusammengekommen – ohne Sie. Sie sind lieber in Nordrhein-Westfalen unterwegs.
Ja, es stimmt: Die Themen, die da während eines Mittagessens diskutiert wurden, sind keine leichte Kost. Es geht um nicht mehr als die Zukunft des europäischen Zertifikatehandels. Der steckt gerade in der schwersten Krise ever, er ist praktisch tot. Die Preise für eine Tonne Kohlendioxid dümpeln zwischen sechs bis acht Euro. Da hat kein Unternehmen einen Anreiz in zusätzliche Klimaschutzmaßnahmen zu investieren, lieber kauft man sich, wie die Österreicher, günstig frei. Auch auf der Einnahmeseite klafft ein Loch. So war das langfristig nicht gedacht.
In Horsens haben Ihre Kollegen nun über einen Lösungsvorschlag geredet: das sogenannte set aside von etwa 1,4 Milliarden Zertifikaten. Die Idee ist simpel: Legt man Zertifikate still, dann steigt der CO2-Preis (aber auch nur, wenn die Zertifikate für immer aus dem Spiel sind). Die Idee wird seit Monaten diskutiert und – sorry, Herr Röttgen: Es ist doch wichtig, dass Sie sich für Deutschland für einen funktionierenden Emissionshandel einsetzen. Klar, werden Sie jetzt sagen, das war doch nur ein informelles Treffen, ich hatte Termine im Wahlkampf in Nordrhein-Westfalen. Aber es wäre eine gute Chance gewesen, die deutsche Position einmal zu verdeutlichen. Ohne dass Ihnen Ihr Ressortkollege Philipp Rösler mal wieder reingrätscht.
Und Sie haben doch heute auch noch einmal betont, dass Deutschland beim Klimaschutz in der EU ehrgeizig bleiben will. Es geht um die Frage, um wie viel Prozent Europa bis 2020 den Kohlendioxidausstoß im Vergleich zu 1990 senkt. Deutschland hat sich ambitionierte 40 Prozent als Ziel gesetzt. In der EU sind´s 20 Prozent. Die Frage ist: Traut sich Europa mehr zu (schließlich werden die 20 Prozent, auch nach Aussage des deutschen Umweltbundesamts heute in der ZEIT, locker erreicht). Und wenn ja: wie viel? 25 Prozent, wie es die EU-Kommission ins Spiel gebracht hat? 30 Prozent? Heute ließ Ihre Pressestelle erklären:
„Minister Röttgen hat nie einen Zweifel daran gelassen, dass aus seiner Sicht eine Erhöhung des EU-Klimaziels für 2020 auf 30 Prozent sinnvoll und erforderlich ist. Nur darf man nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Dieses bezog sich immer auf Maßnahmen innerhalb und außerhalb der EU. Mit seiner Unterstützung der unter anderem von Kommissarin Hedegaard vertretenen Position, EU-intern eine Reduktion von 25 Prozent gegenüber 1990 in 2020 anzustreben, hat er sich hierzu nicht in Widerspruch gesetzt. Über eine bereits jetzt mögliche Anrechung von Klimaschutzprojekten außerhalb Europas kann das Gesamtziel einer Minderung von 30 Prozent erreicht werden. Das ist die Position derjenigen, die Europa in der schwierigen Diskussion konkret voranbringen wollen.“
Sicher, diese Klimaschutzziele sind die großen Fragen – und die können nicht während eines Mittagessens in Horsens geklärt werden. Aber es wäre trotzdem gut gewesen, wenn Sie da gewesen wären. Nicht nur wegen der Symbolik. Sondern vor allem, um die deutsche Position zu erklären und dafür zu werben. Wer in Deutschland von der Energiewende als Chance schwärmt, der muss sich auch dafür einsetzen, dass die europäischen Rahmenbedingungen dafür stimmen. Egal, ob NRW ruft oder nicht.
Update 17:05: Frisch vom Markt aus Horsens: Die EU-Kommission will bis Ende des Jahres Vorschläge vorlegen, um die Auktionierung der Emissionszertifikate neu zu regeln. Hier das Statement von Martin Lidegaard, Klimaminister Dänemark und Connie Hedegaard von der EU-Kommission: