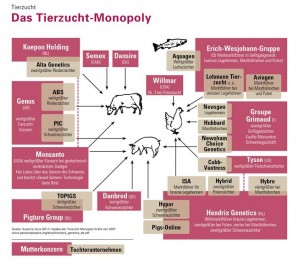Ich muss gestehen: Ich ahnte nichts Böses. Die Pressemitteilung der Umweltschutzorganisation der Vereinten Nationen (Unep) klingt ja wirklich ganz passend für mein Blog: „Green Investments in the Marine Sector Can Bring a Tide of Economic and Social Benefits„, oder?
40 Prozent der Weltbevölkerung leben demnach maximal 100 Kilometer vom Meer entfernt. Die Ozeane bilden für sie, gerade in ärmeren Ländern und den kleinen Inselstaaten, die Lebensgrundlage.
Doch immer öfter ist diese in Gefahr. Jetzt geht es nicht nur um die Klassiker, um Überfischung und Übersäuerung der Weltmeere. Sondern auch um zerstörte Mangrovenwälder und Korallenriffe. Die Studie Green Economy in a Blue World will daher zeigen, wie sich beides verbinden lässt: Meeresschutz und grünes Wachstum.
„Oceans are a key pillar for many countries in their development and fight to tackle poverty, but the wide range of ecosystem services, including food security and climate regulation, provided by marine and coastal environments are today under unprecedented pressure“, said UN Under-Secretary-General and UNEP Executive Director Achim Steiner. „Stepping up green investments in marine and coastal resources and enhancing international co-operation in managing these trans-boundary ecosystems are essential if a transition to low-carbon, resource efficient Green Economy is to be realized.“
Sechs Wirtschaftssektoren schlagen die Autoren vor, um grünes Wachstum anzukurbeln, darunter ökologische Aquakulturen (naa, schon ein bisschen pikant), der Ausbau erneuerbarer Energien und grüner Tourismus an der Küste.
Stutzig machte mich allerdings der letzte Punkt: „Deep See Minerals“. Die Unep empfiehlt die Ausbeutung der Tiefsee, um gerade Entwicklungsländern die Chance zu geben, ihre Wachstumsziele zu erreichen. In der Pressemitteilung wird Peter Prokosch zitiert, der ehemalige WWF-Geschäftsführer in Deutschland und heutige Leiter der Umweltdatenbank des Unep:
„Mining of minerals in the deep-sea provides a unique opportunity for developing countries towards reaching their development goals. Operating in a largely unknown natural environment, it may put additional pressure on already stressed marine ecosystems. However, it can relieve some of the burdens of mining in the terrestrial environment. Careful and responsible planning of deep-sea minerals mining needs to apply the Precautionary Principle, and consider the other sectors and in particular future generations.“
Nun muss man dem UNEP bzw. Herrn Prokosch zugutehalten: Er warnt vor den Eingriffen in die Tiefsee und fordert ein Vorgehen nach einem umfassenden Vorsorgeprinzip. Trotzdem war ich heute Abend erst einmal baff. Was soll diese Forderung? Gibt es nicht in den anderen fünf Sektoren erst einmal ausreichend Entwicklungspotenzial? Eine solch unbekannte Region wie die Tiefsee sollte meiner Meinung nach erst einmal der Wissenschaft exklusiv vorbehalten sein. Erst einmal sollten wir doch Erkenntnisse gewinnen, was dort unten los ist, bevor wir das Terrain gleich zur Plünderung frei geben. Zumal die Folgen dieser Eingriffe ja vollkommen unbekannt sind. Und welche Konsequenzen missglückte Eingriffe haben, hat das BP/Deep Water Horizon-Unglück im Golf von Mexiko ausreichend gezeigt.