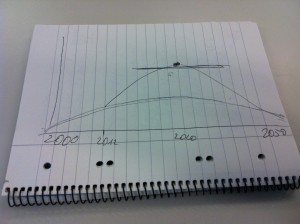Das Folgende läuft unter der Kategorie „Na, geht doch“. In Schleswig-Holstein hat E.on Netz Anfang August ein Pilotprojekt gestartet. Es erhöht die Übertragungskapazität der 110 kv-Leitungen um bis zu 50 Prozent. Das ist jetzt, wo allenorts über den Netzausbau gestritten wird und Bürger sich gegen neue Stromleitungen in ihrer direkten Umgebung aussprechen, ein wirklich spannendes Projekt. Und vor allem wichtig für Schleswig-Holstein, wo die Windenergie an Land ja noch radikal ausgebaut werden soll und der Netzausbau nicht hinterkommt.
Das so genannte Auslastungsmanagement auf zwei Pilotstrecken klingt zuerst einmal widersprüchlich: E.on Netz schaltet Windräder vom Netz ab. Aber, und das ist der Unterschied zur bisherigen Praxis, das passiert nur noch bei einem Störfall. Bislang war es so, dass Techniker in der Schaltzentrale von E.on einzelne Windräder manuell und in Stufen abgeschaltet haben, wenn das Netz komplett ausgelastet war (Einspeisemanagement). Der Windparkbetreiber findet das natürlich nicht prickelnd, weil er seinen Ökostrom nicht mehr vergütet bekommt. Aber die Netzbetreiber müssen ihm eine Ausgleichsvergütung zahlen.
Jetzt probiert E.on auf den Pilottrassen (ingesamt betrifft das rund 200 Windräder mit einer Kapazität von 400 Megawatt) ein automatisiertes Verfahren. Die Windräder werden per Computer sofort komplett abgeschaltet. Das passiert aber nur noch im wirklichen Ernst-, sprich im Störfall. Und das ist dann weitaus seltener als sonst. So nutzt E.on Reservekapazitäten im Netz aus. Die Folge: Es kann zwar sein, dass Windräder abgeschaltet werden, trotzdem landet aber mehr Ökostrom im Netz. Drei Millionen Euro hat E.on in die Technik investiert.
Im Netz geht also noch was. Erst recht, wenn man sich anschaut, dass E.on in Schleswig-Holstein auch noch Freileitungsmonitoring betreibt. Die Idee ist simpel: Der Wind kühlt Stromleitungen. Und wenn´s dann draußen auch noch schön knackig kalt ist, erhöht das die Übertragungskapazitäten des Stromnetzes auch noch einmal um bis zu 5o Prozent.
Dass so viel Musik noch im Netz drin ist, hätte E.on wohl selbst vor ein paar Jahren nicht gedacht.