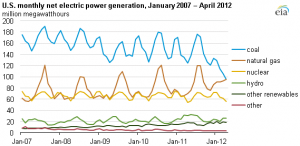Man man man, Maria Damanaki ist ehrgeizig. Die EU-Fischereikommissarin will im Nordostatlanik ein Fischereiverbot für die Tiefsee durchsetzen. In einem Vorschlag zur Neuregelung der Tiefseefischerei fordert sie ein komplettes Verbot für Grundschleppnetze und Stellnetze ab 1000 Metern, für manche Fischereien in der Region sogar schon ab 500 Meter. Den Fischern will sie eine Übergangsfrist von zwei Jahren gewähren.
Chapeau, sagen selbst die Umweltschützer – die oft ja vieles an der EU-Kommission zu bekritteln haben. Sie sorgen sich seit Jahren um das sensible und bislang kaum erforschte Ökosystem in der Meerestiefe. De facto wird der Meeresboden mit Grundschleppnetzen einmal umgefräst. Stephan Lutter vom WWF:
„Der Kommissionsvorschlag kann die Fischerei revolutionieren, indem er die destruktivste aller Fischereimethoden in der sensiblen Tiefsee abschafft. Das wäre ein echter Durchbruch für den Schutz der Meeresumwelt und ein Vorbild für die weltweite Fischerei.“
Der Vorschlag der EU-Kommissarin ist revolutionär, weil es bislang kein umfassendes Verbot für die Tiefseefischerei in der Region gibt, sondern nur einen Flickenteppich an Schutzgebieten. Umweltschützer müssen um jedes Gebiet, in dem strengere Standards herrschen sollen, oftmals jahrelang Kämpfe ausfechten.
So vielleicht auch in diesem Fall. Jüngst grätschte der ehemalige französische Landwirtschaftsminister und aktuelle Binnenmarktskommissar Michel Barnier seiner Amtskollegin in die Beine und stoppte ihr Vorhaben zwischenzeitlich. Seine Motive sind offensichtlich: Er sorgt sich vor allem um das Geschäft der französischen Supermarktkette Intermarche. Der Konzern besitzt mehrere Trawler, die gerade in der Tiefsee fischen. Kaum überraschend, dass Barnier bereits Klientelpolitik vorgeworfen wird.
Das wird umso deutlicher, wenn man sich ein aktuelles Q&A der EU-Kommissarin anschaut. Darin bewertet sie die wirtschaftliche Bedeutung der Tiefseefischerei. Demnach machen Tiefseefische wie der Granatbarsch oder der Schwarze Degenfisch gerade einmal ein Prozent der gesamten Anlandungen aus der Region Nordostatlanik aus. Auch die Jobs sind, wenn man das große Bild vor Augen hat, aus Sicht der EU-Kommission vernachlässigbar:
“ The Commission believes that the overall economic importance of deep-sea catches is small.“
Ob Damanaki sich allerdings gegen die Fischereinationen Spanien, Portugal und Frankreich durchsetzen kann, ist unklar. Umweltschützer hoffen jetzt auf eine breite Unterstützung im EU-Parlament.