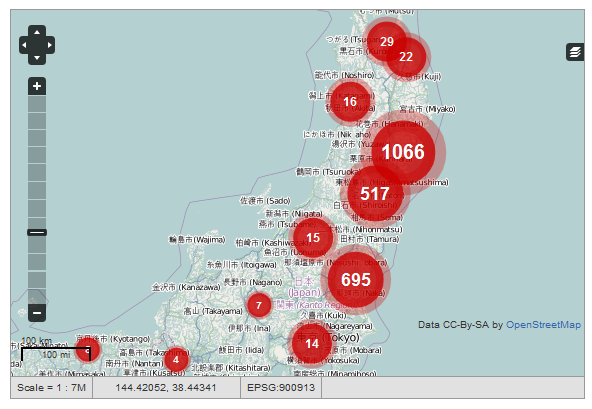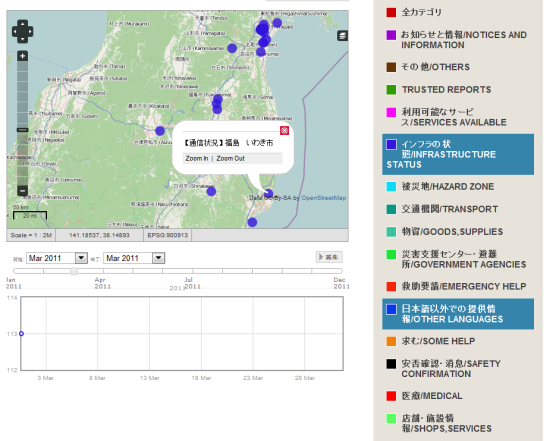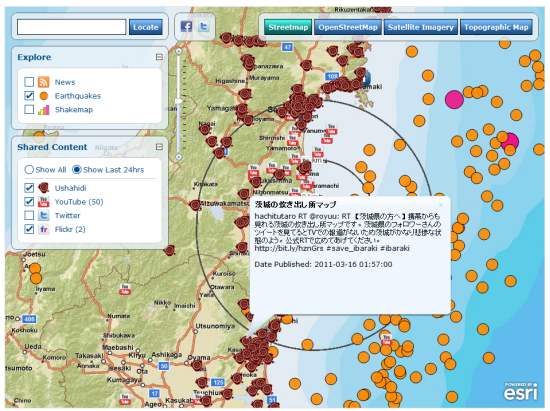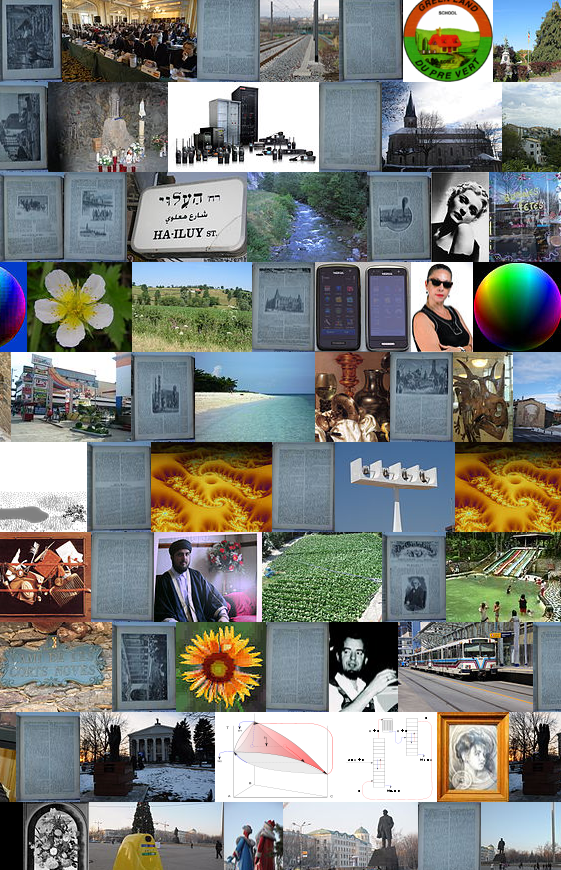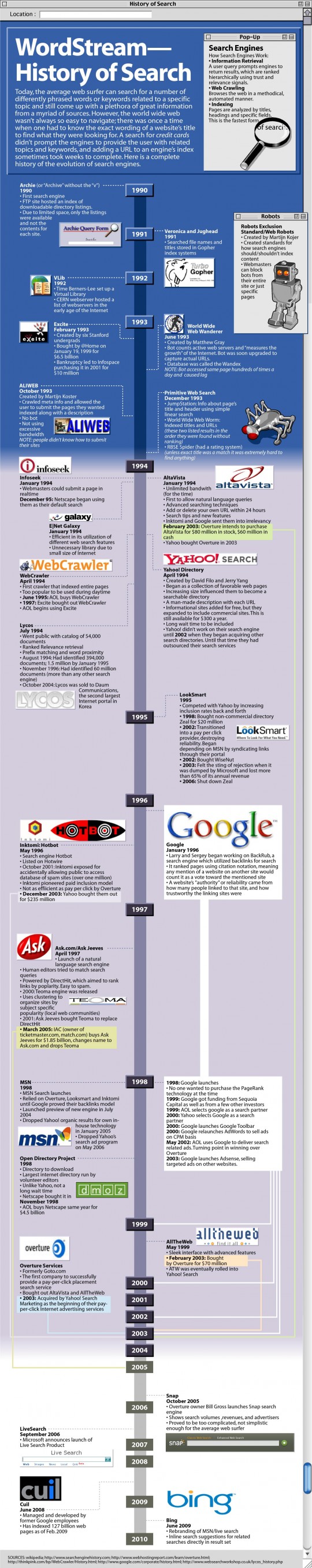Die Internet-Enquête hat nach langem Ringen eine Plattform für den „18. Sachverständigen“ eingerichtet. Erwartet wurden „tausende“ engagierter Bürger. Angesichts einer hohen Alphabetisierungsrate sowie einer stetig kleiner werdenden „Digitalen Kluft“ ist das bei einer Bevölkerung von rund 80 Mio. Einwohnern ein eher bescheidenes Ziel. Tausend Sachverständige entsprächen nämlich einer groben Schätzung zufolge einer Beteiligungsrate von 0,0000125 Prozent der Bevölkerung. Eine realistische Zielvorgabe?
Die Resonanz ist bislang recht überschaubar: Gerade beim Thema Datenschutz ließe sich trefflich streiten. Doch tatsächlich meldeten sich nur ganz wenige. Zwei bis drei Stimmen konnten einzelne Themenvorschläge auf sich versammeln. Insgesamt lässt sich damit die Bilanz nach drei Wochen Diskussionszeit mit einem durchschnittlichen Blog vergleichen.
Das Thema „Datenschutz und Persönlichkeitsrechte“ fand insgesamt 101 Mitglieder, mit nur 46 Vorschlägen sowie mageren 48 Kommentaren (wobei ich selbst die Statistik heute morgen, also bereits nach dem offiziellen Redaktionsschluss, um 9 Kommentare geschönt habe). Es gibt im Moment also 1 Kommentar pro Vorschlag. So sieht keine Debatte aus.
Da liefen die drei Debatten zu Netzneutralität, Urheberrecht und Medienkompetenz noch ein wenig reger: Bei der Netzneutralität waren es 188 Mitglieder mit 9 Vorschlägen und 119Kommentaren, beim Urheberrecht 283 Mitglieder, 25 Vorschläge, 256 Kommentare. Bei der Medienkompetenz waren es jedoch nur 148 Mitglieder mit 16 Vorschlägen und 92 Kommentaren.
Müßig festzustellen, dass – vorausgesetzt, die Mitglieder doppeln sich nicht – im Moment 720 Mitglieder aktiv sind – und dass dies einer Beteiligungsrate von 0,000009 Prozent entspräche. Das Ziel wurde damit knapp verfehlt. Wirklich irritierend ist es, dass das Engagement mit der Zeit offenbar nicht zu-, sondern abnimmt. Woran kann das liegen?
Ich vermute, dass sich auch Adhocracy wie jedes Blog, jedes Forum erst einmal etablieren muss. Und dass immer wieder Anstrengungen unternommen werden müssen, um die Aufmerksamkeit auf den „18. Sachverständigen“ zu ziehen. Am meisten helfen wohl Verlinkungen, die auf neue Beiträge verweisen. Twitter wäre ein ideales Mobilisierungsinstrument, ist jedoch nicht direkt eingebunden. Verweise der 17 anderen Sachverständigen sowie der Politiker auf die Plattform wären vermutlich auch hilfreich, um die Vernetzung zu verbessern.
Wenig Resonanz findet übrigens auch ein Positionspapier einer Arbeitsgruppe des Dialog Internet des Bundesfamilienministeriums zum eigentlich sehr umstrittenen Thema Jugendschutz, das seit dem 9. Mai im Etherpad-Format kommentierbar ist.