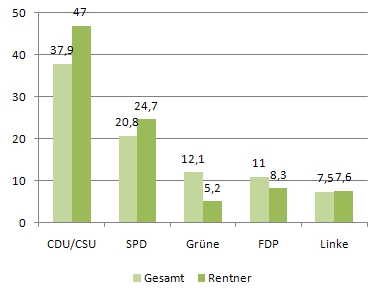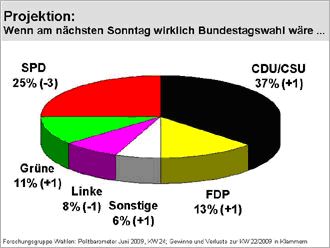Der Wahlkampf hat (wenn auch nur für eine kurze Zeit) ein heißes Sommerthema gefunden: Wirtschaftsminister Karl-Theodor zu Guttenberg hat von einer Kanzlei die Vorlage für ein Gesetz zur Zwangsverwaltung für angeschlagene Banken ausarbeiten lassen. Die Vorwürfe in diesem Zusammenhang sind vielfältig und nicht alle gleichermaßen stichhaltig. Zum einen heißt es, zu Guttenberg hätte die Expertise und das Fachwissen seines personell gut ausgestatteten Ministeriums nutzen sollen, um eine Gesetzesvorlage zu erarbeiten. Doch dieses Phänomen des „Outsourcing“ ist in der Politik wohlbekannt und sehr viel häufiger anzutreffen als nach außen hin sichtbar: Die immer komplexeren politischen Zusammenhänge, die viel zitierte Mehrebenenproblematik oder das Schnittstellenmanagement zwischen verschiedenen Institutionen und Entscheidungsträgern erfordern schlichtweg sehr viel und sehr spezialisierte Expertise, die ein einziges Ministerium alleine nicht immer aufbringen kann. Untersuchungen, wie etwa die vom ZDF zitierte, und wissenschaftliche Analysen (vgl. Falk/Römmele 2009) zeigen deutlich, dass der Beratungsbedarf von Ministerien und anderen öffentlichen Einrichtungen in den letzten Jahren deutlich gewachsen ist. Das Wirtschaftsministerium stellt hier keine erwähnenswerte Ausnahme dar.
Der Wahlkampf hat (wenn auch nur für eine kurze Zeit) ein heißes Sommerthema gefunden: Wirtschaftsminister Karl-Theodor zu Guttenberg hat von einer Kanzlei die Vorlage für ein Gesetz zur Zwangsverwaltung für angeschlagene Banken ausarbeiten lassen. Die Vorwürfe in diesem Zusammenhang sind vielfältig und nicht alle gleichermaßen stichhaltig. Zum einen heißt es, zu Guttenberg hätte die Expertise und das Fachwissen seines personell gut ausgestatteten Ministeriums nutzen sollen, um eine Gesetzesvorlage zu erarbeiten. Doch dieses Phänomen des „Outsourcing“ ist in der Politik wohlbekannt und sehr viel häufiger anzutreffen als nach außen hin sichtbar: Die immer komplexeren politischen Zusammenhänge, die viel zitierte Mehrebenenproblematik oder das Schnittstellenmanagement zwischen verschiedenen Institutionen und Entscheidungsträgern erfordern schlichtweg sehr viel und sehr spezialisierte Expertise, die ein einziges Ministerium alleine nicht immer aufbringen kann. Untersuchungen, wie etwa die vom ZDF zitierte, und wissenschaftliche Analysen (vgl. Falk/Römmele 2009) zeigen deutlich, dass der Beratungsbedarf von Ministerien und anderen öffentlichen Einrichtungen in den letzten Jahren deutlich gewachsen ist. Das Wirtschaftsministerium stellt hier keine erwähnenswerte Ausnahme dar.
Ein zweiter Kritikpunkt jedoch trifft den Kern des Problems: Eine Kanzlei hat ein wirtschaftliches Eigeninteresse und vertritt zudem eine Reihe von Unternehmen, die bestimmte Wünsche an die Politik herantragen möchten. Diese gemeinhin als „Lobbying“ bezeichneten Aktivitäten sind ebenso wie das Beanspruchen externer Berater übliche Praxis. Allerdings sind die Europäische Union und einige Nichtregierungsorganisationen darum bemüht, diese Lobbyingprozesse transparent und nachvollziehbar zu gestalten. Die These lautet: Nur wenn die Akteure und ihre Interessen bekannt sind, kann das Lobbying richtig eingeschätzt werden – und nur dann wird der Demokratie kein Schaden zugefügt. Der im vorliegenden Fall beauftragten Kanzlei wurde so gesehen die große Chance gewährt, einen sehr direkten Einfluss auf einen Gesetzentwurf nehmen zu können, ohne etwa die Namen ihrer Klienten, die von einem solchen Gesetz betroffen sein könnten, öffentlich machen zu müssen. Der Wirtschaftsminister muss sich also vorwerfen lassen, verdecktes Lobbying zugelassen zu haben.
Und drittens steht der Zeitpunkt dieses Vorganges in der Kritik. Da das Gesetz nicht mehr in dieser Legislaturperiode verabschiedet werden kann, ist die Vorlage der Kanzlei de facto hauptsächlich Munition für den Bundestagswahlkampf. Die Forschung unterscheidet hier sehr genau zwischen verschiedenen Formen der Politikberatung. Im Falle von Gesetzesvorlagen, die also die „materielle Politik“ betreffen, sollte die Beratungsleistung „objektiv“ sein. Schließlich soll jedes Gesetz seinem Anspruch nach dem Wohle des Volkes dienen. In der Wahlkampfberatung hingegen werden Konzepte und Kampagnen verlangt, die auf die Ziele der jeweiligen Partei und die Ansprache ihrer Wähler zugeschnitten sind. Hier geht es nicht um hehre Ziele wie Objektivität oder Neutralität; kämpfen ist angesagt. Wenn nun eine der Form nach objektive Beratungsleistung für den Wahlkampf verwendet wird, lässt dies Rückschlüsse auf die Verbindungen zwischen Ministerium und Kanzlei zu und wirft Fragen nach der Objektivität vorangegangener Beratungen auf.
Übrigens: Wenn Justizministerin Brigitte Zypries nun ihr Ministerium dazu antreibt, ebenfalls einen Entwurf vorzulegen, der offensichtlich auch ihrem Wahlkampf dienen wird, macht sie sich des selben Vergehens schuldig, wie ihr Kollege zu Guttenberg. Denn egal, ob nun externe Berater oder die Ministerien selbst damit beschäftigt sind: Diese Arbeit kostet Steuergelder und aus diesem Grund darf sie nicht für den Wahlkampf verwendet werden. Wahlkampfkosten sind in Deutschland Sache der Parteien (die dann wiederum vom Bund nach bestimmten Regeln finanziert werden). Ministerien aber haben sich dem Wohle des Volkes und nicht dem bestimmter Parteien zu widmen.
Literatur:
Falk, S., & Römmele, A. (2009). Der Markt für Politikberatung. Wiesbaden: VS Verlag.