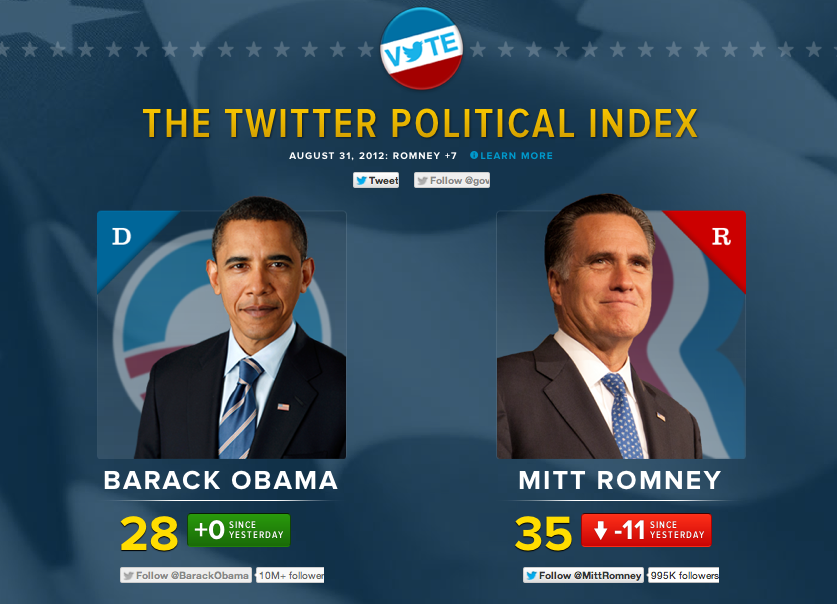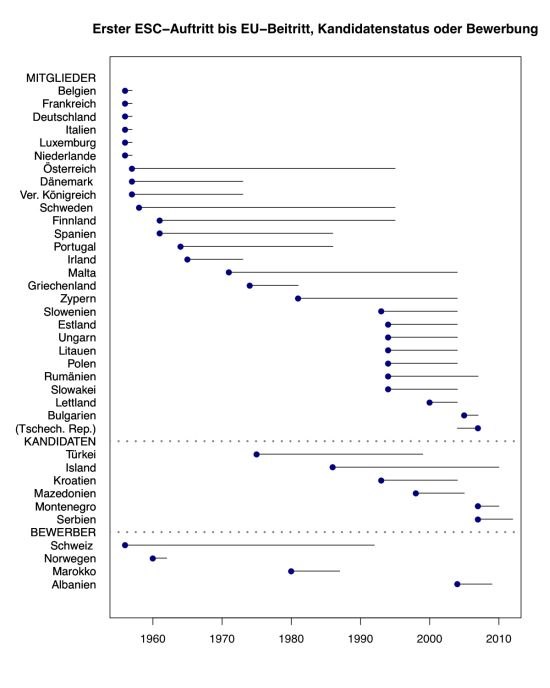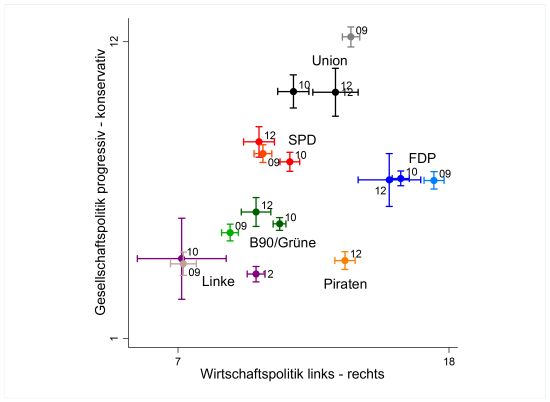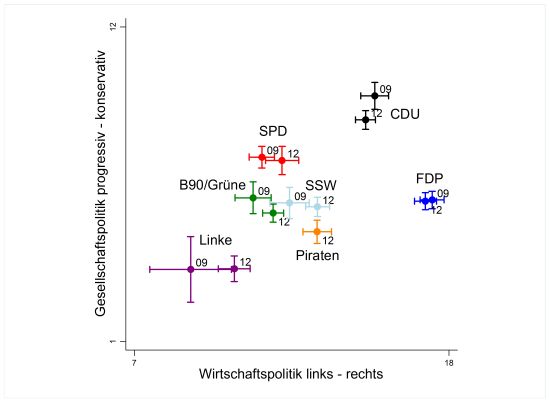Von Christian Hesse
Wer sich für Wahlrecht interessiert, weiß, dass eine äußerst wichtige Entscheidung ansteht, die uns alle angeht. Am 25. Juli wird in Karlsruhe ein höchstrichterliches Urteil dazu verkündet. Worum geht`s?
Ende letzten Jahres wurde von der Regierungskoalition gegen die Stimmen der Opposition ein neues Wahlrecht für die Wahl zum Bundestag verabschiedet. Das alte musste überarbeitet werden, nachdem das Bundesverfassungsgericht es für verfassungswidrig erklärt hatte. Grund dafür war die Besonderheit, dass unter bestimmten Umständen mehr Zweitstimmen für eine Partei dazu führen konnten, dass diese Partei seltsamerweise einen Sitz verliert. Der mit diesen Stimmen zum Ausdruck gebrachte Wählerwille würde also ins krasse Gegenteil verkehrt. Man spricht von Negativem Stimmgewicht. Als bei der Bundestagswahl 2005 in einem Wahlkreis nachgewählt werden musste, trat dieser Störfall tatsächlich auf.
Am neuen Wahlrecht erhitzen sich die Gemüter. SPD und Grüne haben in Karlsruhe dagegen geklagt. Auch in der Presse steht es fast einhellig in der Kritik. Von „einem unverschämten Anschlag auf die repräsentative Demokratie“ (Volker Beck) war sogar die Rede.
Am 5. Juni hat das Verfassungsgericht zum Wahlrecht verhandelt. Als vom Gericht geladener Sachverständiger habe ich daran teilgenommen. Wie man sich vorstellen kann, gehört ein Auftritt in dieser Manege nicht zu den Standardsituationen im Leben eines Mathematikers. Die Verhandlung war ein Ringen um die Deutungshoheit im wahlrechtlichen Raum zwischen Befürwortern und Kritikern des neuen Wahlrechts. Beide Seiten hatten als Verfahrensvertreter renommierte Staatsrechtler und viel Polit-Prominenz aufgeboten. Am Ende eines sehr langen Verhandlungstages hatten die Befürworter gegen die Kritiker einen klaren inhaltlichen Punktsieg erzielt. Während der Verhandlung gab es viele präzise Fragen der Verfassungsrichter an die Verfahrensbeteiligten. Aus ihnen konnte eine Tendenz des Gerichts jedoch nicht abgeleitet werden.
Wie funktioniert das neue Wahlrecht?
Das System aus Erst- und Zweitstimme wird beibehalten. Neu ist, dass zuerst für jedes Land nach der Wahlbeteiligung errechnet wird, wie viele Abgeordnete von dort in den Bundestag ziehen. Anschließend wird nach dem Verhältnis der Zweitstimmen in jedem Land festgelegt, wie viele dieser Abgeordneten welcher Partei angehören. Zusätzlich eingeführt wurde eine Korrektur von Rundungsverlusten. Nach wie vor zieht jeder Wahlkreissieger ins Parlament ein. So können auch im neuen Wahlrecht Überhangmandate auftreten. Diese entstehen dann, wenn eine Partei mehr Sitze durch Wahlkreisgewinner erringt als ihr nach Zweitstimmen eigentlich zustehen. Kurzum: Das neue Wahlrecht ist kompliziert. Aber auch das alte war nicht einfach.
Welche Auswirkungen hat es?
Vom Ergebnis aus gesehen ist das neue Wahlrecht minimal-invasiv. Bei dessen Anwendung auf die letzten sechs Bundestagswahlen seit 1990, hätte die SPD insgesamt ein Plus von 3 Sitzen erzielt, die CDU Plus/Minus 0, die CSU Plus/Minus 0, die FDP ein Plus von 10 Sitzen, die Grünen ein Plus von 11 Sitzen, Die Linke ein Plus von 9 Sitzen. Das ist kein großer Unterschied, und dies ist als Vorteil zu werten. Denn das deutsche System aus Mehrheitswahl und Verhältniswahl stößt auf breite Zustimmung in der Bevölkerung. Es ist verfassungspolitisch bewährt, gilt überwiegend als erhaltenswert und wird in der wissenschaftlichen Literatur meist positiv beurteilt. Es ist ein Erfolgsmodell und ein großes Gut unserer politischen Kultur. Wahlrecht made in Germany hat sogar andernorts (Neuseeland) als Vorbild gedient.
Wurden monierte Mängel beseitigt?
Es ist eine Binsenweisheit unter Wahlrechtlern, dass das perfekte Modell eine Utopie ist. Gemeinhin ist es für Experten nicht schwer, an einem Wahlsystem unerwünschte Eigenschaften aufzuzeigen, doch unmöglich, ein System zu entwickeln, das ganz frei davon ist. Alle haben ihre Vor- und Nachteile. Das von der SPD favorisierte Modell verursacht eine erhebliche Aufblähung des Parlaments. Das Modell der Grünen benachteiligt Landesverbände ohne Überhangmandate.
Das Verfassungsgericht hatte übrigens nicht die Überhangmandate bemängelt. Es hatte allein das oben angesprochene Negative Stimmgewicht als verfassungswidrig eingestuft. Und es hatte zudem eine mögliche Beseitigung vorgeschlagen, die nicht an Überhangmandaten ansetzt, sondern die Bundesländer zu getrennten Wahlgebieten macht. Dieser Weg wurde beschritten.
Negative Stimmgewichte sind zwar auch im neuen Wahlrecht noch möglich. Die Wahrscheinlichkeit ihres Auftretens wird aber stark zurückgedrängt. Bei realitätsnah simulierten Wahlausgängen treten sie nur etwa bei jedem hundertsten Wahlergebnis auf. Kein einziger Fall von Negativem Stimmgewicht gemäß Definition des Verfassungsgerichts wäre unter dem neuen Wahlrecht bei den Bundestagswahlen 2005 und 2009 aufgetreten. Das Gericht hatte die Beseitigung dieses Defekts außerdem nur für im politischen Alltag auftretende Szenarien verlangt, nicht unbedingt für alle theoretisch möglichen Situationen. Dieser Auftrag wurde erfüllt.
Negative Stimmgewichte sind ein gegenläufiger Effekt, der sich allein auf Änderungen bei den Zweitstimmen bezieht. Daneben können im neuen Wahlrecht gegenläufige Effekte auftreten, die als Ursachen gleichzeitige Änderungen bei Erst- und Zweitstimmen voraussetzen. Alle diese Effekte können aber vom Wähler nicht für strategisches Wählen oder manipulatives Verschieben von Sitzen eingesetzt werden. Nur nach der Wahl wird feststellbar, ob und wo sich dieser Effekt durch Rundungszufälle ergeben hätte. Insgesamt wird die Bedeutung gegenläufiger Effekte von vielen Kritikern des neuen Wahlsystems bei weitem überschätzt. Nichtsdestoweniger hätte der Gesetzgeber in der eingeschlagenen Richtung noch einen kleinen Schritt weitergehen sollen, um alle gegenläufigen Effekte zu beseitigen. Das ist erreichbar, würden die Sitze auf die Bundesländer nicht nach Wahlbeteiligung, sondern nach Bevölkerung verteilt und die Rundungsverluste der Parteien nach eingebüßten Sitzbruchteilen korrigiert. In der Endabrechnung macht beides nur wenig aus.
Ist das neue Wahlrecht fair?
Wer diese Frage beantworten will ohne Überhangmandate zu erwähnen, hätte das Thema von vornherein verfehlt. Für die Opposition sind diese Mandate ein rotes Tuch. Bei der letzten Wahl gab es davon die satte Zahl von 24 und alle konnte die Union einheimsen. Das war nicht immer so. Bei den Bundestagswahlen von 1990 bis 2005 hatte die CDU zusammen genommen 26, die SPD 30 Überhangmandate bekommen. Das Verhältnis war also bis vor der letzten Wahl relativ ausgeglichen. Und diese letzte Wahl kann insofern als Sonderfall gelten, als eine der großen Volksparteien ausgesprochen schwach und eine der kleinen Parteien ausgesprochen stark war. Die weitere Entwicklung der Überhangmandate ist schwer vorherzusagen. Es gibt aber seriöse Schätzungen, dass diese bei der nächsten Wahl mehrheitlich der SPD zugute kommen werden. Jedenfalls hat die Union kein festes Abonnement auf diese Mandate.
Auch ist das neue Wahlrecht aufs Ganze gesehen für kleine Parteien weniger nachteilig als es das alte war. Ferner wirkt sich die Vergabe der Sitze an die Länder nach Wahlbeteiligung im Vergleich mit der Zuteilung nach Bevölkerung nicht negativ für die neuen Länder aus, obwohl dort typischerweise weniger Wählerinnen und Wähler zur Wahlurne gehen. Zieht man Bilanz, ist das neue Wahlrecht, trotz vorhandener Fragwürdigkeiten, ausreichend fair. Vielleicht wird es Zeit, seinen Frieden damit zu machen und Ja dazu zu sagen, wenn auch nicht Hurra.
Christian Hesse ist Professor für Mathematische Statistik am Institut für Stochastik und Anwendungen der Universität Stuttgart. Er war im Rahmen der Verhandlung des neuen Wahlrechts vor dem Bundesverfassungsgericht Gutachter für die CDU/CSU-Bundestagsfraktion.