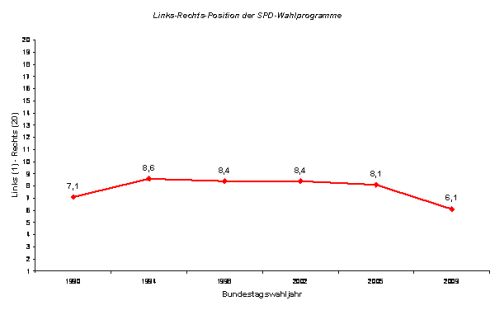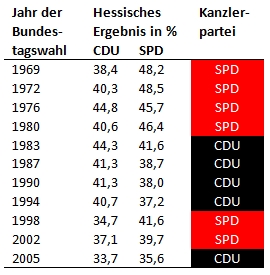Das Stilmittel ist in Deutschland noch immer außergewöhnlich: Die SPD eröffnet den Europawahlkampf 2009 mit einer Plakatkampagne, die dem vor allem aus den USA bekannten „negative campaigning“, dem Attackieren des politischen Gegners, sehr nahe kommt. Auf einem Wahlplakat steht beispielsweise der Slogan „Finanzhaie würden FDP wählen“, daneben prangt ein offensichtlich gefräßiger Hai. Erst bei genauerem Hinsehen entdeckt der Betrachter in der rechten unteren Ecke das Logo der SPD samt der programmatischen Forderung: „Für ein Europa, in dem klare Regeln gelten“. Außer dem Finanzhaie-Poster wurden auf der Internet-Plattform „Wahlkampf 09″ auch noch zwei weitere Plakate der Kampagne vorgestellt, welche die CDU als Befürworterin von Dumpinglöhnen und die Politik der Linkspartei als „heiße Luft“ bezeichnen.
Das Stilmittel ist in Deutschland noch immer außergewöhnlich: Die SPD eröffnet den Europawahlkampf 2009 mit einer Plakatkampagne, die dem vor allem aus den USA bekannten „negative campaigning“, dem Attackieren des politischen Gegners, sehr nahe kommt. Auf einem Wahlplakat steht beispielsweise der Slogan „Finanzhaie würden FDP wählen“, daneben prangt ein offensichtlich gefräßiger Hai. Erst bei genauerem Hinsehen entdeckt der Betrachter in der rechten unteren Ecke das Logo der SPD samt der programmatischen Forderung: „Für ein Europa, in dem klare Regeln gelten“. Außer dem Finanzhaie-Poster wurden auf der Internet-Plattform „Wahlkampf 09″ auch noch zwei weitere Plakate der Kampagne vorgestellt, welche die CDU als Befürworterin von Dumpinglöhnen und die Politik der Linkspartei als „heiße Luft“ bezeichnen.
„Negative campaigning“ ist umstritten, auch in der Wissenschaft. Zum einen widersprechen sich die durchgeführten Studien erheblich in der Frage, ob ein solcher Wahlkampf wirklich der eigenen Partei nützt. Schließlich werden primär nicht die eigenen Stärken, sondern die mutmaßlichen Schwächen des Gegners betont. Diese Form der politischen Auseinandersetzung könnten einige Wählerinnen und Wähler für unangebracht halten. Viele Wahlkampfmanager nehmen demnach offenbar in Kauf, dass unter einer solchen Negativkampagne das Ansehen der eigenen Partei leiden könnte. Man baut jedoch darauf, dass dieser Ansehensverlust sehr viel geringer ist als der, den die attackierte Partei zu erleiden hat.
Allerdings basieren die meisten Untersuchungen zu diesem Thema auf Wahlen in den USA, wo sich Wahlkämpfe gewöhnlich auf ein Duell zweier Parteien oder Kandidaten zuspitzen. Vermutlich wirkt die Logik („Der Verlust meines Gegners ist mein Gewinn“) hier besser, als in einem System mit fünf Parteien. Man könnte ja vermuten, dass von einem Plakat, auf dem die SPD die CDU angreift, insbesondere FDP, Grüne und Linkspartei profitieren. Dies mag ein Grund dafür sein, dass „negative campaigning“ bisher in deutschen Wahlkämpfen noch keine große Rolle spielt und auch die SPD hier eine vergleichsweise milde Variante gewählt hat.
Zum anderen kommen auch aktuelle Studien noch zu sehr unterschiedlichen Einschätzungen bezüglich der Effekte von Negativkampagnen auf die Wahlbeteiligung. Während einige Forscherinnen und Forscher keinen Einfluss sehen, weisen andere darauf hin, dass die Wahlbeteiligung unter diesen Kampagnen leiden könnte. Das Statement von SPD-Wahlkampfleiter Kajo Wasserhövel, diese „ungewöhnliche Kampagne“ werde Aufmerksamkeit erregen und die Wahlbeteiligung stärken, scheint jedenfalls bisher empirisch nicht belegbar zu sein.
Wir werden sehen, ob die Kampagnen im Superwahljahr 2009 an diesen Befunden etwas ändern werden…