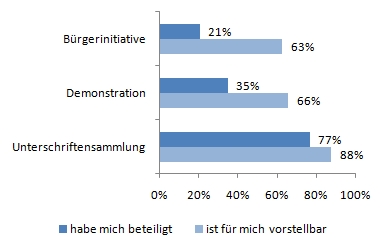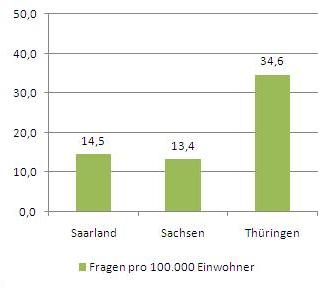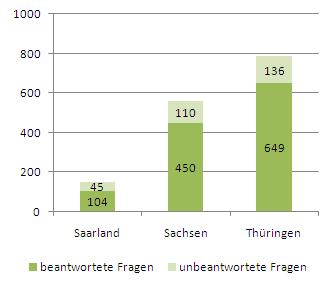Es gibt für sie nur unschöne Bezeichungen wie Wahlnachfragen, Wahltag- oder Wahltagsbefragungen. In exit polls werden am Wahltag Wähler, die gerade das Wahllokal verlassen haben (exit), mit einem Kurzfragebogen nach ihrer Wahlentscheidung, einigen wenigen möglichen Erklärungen hierfür und nach zentralen sozio-demographischen Merkmalen wie Geschlecht, Alter, Berufsgruppenzugehörigkeit etc. befragt (poll). Die Umfrageinstitute und Fernsehsender erstellen auf der Grundlage dieser Daten ihre sogenannten 18-Uhr-Prognosen, und auch für die ersten Hochrechnungen werden diese Daten immer noch mitverwendet. Darüber hinaus ermöglichen die Exit-Poll-Daten erste Einblicke in die Hintergründe der Wahl, vor allem im Kontrast zu Ergebnissen der jeweiligen exit poll bei der Vorwahl. So ließ sich zum Beispiel in den letzten Jahren immer sehr schön zeigen, wie die Linke sukzessive bei Arbeitslosen erfolgreich wurde, bei denen zuvor die SPD dominierte.
Es gibt für sie nur unschöne Bezeichungen wie Wahlnachfragen, Wahltag- oder Wahltagsbefragungen. In exit polls werden am Wahltag Wähler, die gerade das Wahllokal verlassen haben (exit), mit einem Kurzfragebogen nach ihrer Wahlentscheidung, einigen wenigen möglichen Erklärungen hierfür und nach zentralen sozio-demographischen Merkmalen wie Geschlecht, Alter, Berufsgruppenzugehörigkeit etc. befragt (poll). Die Umfrageinstitute und Fernsehsender erstellen auf der Grundlage dieser Daten ihre sogenannten 18-Uhr-Prognosen, und auch für die ersten Hochrechnungen werden diese Daten immer noch mitverwendet. Darüber hinaus ermöglichen die Exit-Poll-Daten erste Einblicke in die Hintergründe der Wahl, vor allem im Kontrast zu Ergebnissen der jeweiligen exit poll bei der Vorwahl. So ließ sich zum Beispiel in den letzten Jahren immer sehr schön zeigen, wie die Linke sukzessive bei Arbeitslosen erfolgreich wurde, bei denen zuvor die SPD dominierte.
Aufgrund des Durchsickerns von Ergebnissen einiger Exit-Poll-Daten, das in diesem Blog schon länger und wiederholt von Thorsten Faas thematisiert wurde und deshalb hier per se nicht mehr diskutiert werden muss, entbrannte nun eine Diskussion über ein mögliches Verbot der Wahlnachfragen. Man müsse sicher gehen, so die Argumentation, dass jeder Wähler bis zur Schliessung der Wahllokale seine Stimme ohne Kenntnis von Zwischenergebnissen abgeben kann. Dies ist grundsätzlich ein ehrenwertes Ansinnen, das mindestens zwei Fragen nach sich zieht: 1. Beeinflusst die Kenntnis von (Zwischen)Ergebnissen die Wahlentscheidung? 2. Ist der mögliche Schaden der exit polls größer als ihr Nutzen?
Zur ersten Frage lässt sich sagen, dass eine gewisse Beeinflussung nicht auszuschliessen ist. Ein oft zitiertes Beispiel sind die USA. Hier werden nach der Schließung der Wahllokale an der Ostküste die Ergebnisse der dortigen exit polls veröffentlicht. In vielen anderen Bundesstaaten wissen also diejenigen Wähler, die bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht gewählt haben, wie in anderen Landesteilen gewählt wurde. In diesem Zusammenhang gibt es im Kern zwei Effekte: Scheint die Wahl deutlich auszugehen, dann ist der Anreiz, noch zu wählen, gering. Ist es knapp, dann mag erst recht jede Stimme zählen. Beide Effekte, die primär Beteiligungseffekte sind, wurden schon beobachtet.
Zur zweiten Frage wird von den Umfrageinstituten gerne auf den wissenschaftlichen Nutzen der exit polls verwiesen. Dieser ist, nüchtern betrachtet, moderat. Ohne Zweifel einmalig sind die hohen Befragtenzahlen von 20.000 Wählern und mehr, verglichen mit 1.000 bis 2.000 Befragten in üblichen Umfragen. Andererseits sind die Exit-Poll-Fragebögen in Deutschland (anders als bspw. in den USA) mit ein bis zwei Seiten sehr kurz, so dass nur sehr wenige Fragen aufgenommen und später zur Kommentierung und Teil-Analyse des Wahlergebnisses herangezogen werden können. Ohne Umfragedaten, die vor und nach der Wahl erhoben werden, lassen sich die Wahlergebnisse nicht wirklich gut erklären. Darüber hinaus werden Exit-Poll-Daten, anders als viele Umfragedaten, der Wissenschaft nicht oder nur in Ausnahmefällen zur Sekundäranalyse zur Verfügung gestellt. Und für die Umfrageinstitute ist die Wahl spätestens mit der Erstellung ihrer Wahlberichte ein bis zwei Wochen nach der Wahl „gelaufen“. Die Exit-Poll-Daten, deren Erhebung sehr viel Geld kostet (und im Übrigen von uns allen durch die Rundfunk- und Fernsehgebühren mitfinanziert werden), verschwinden in den Schubladen der Institute. Sie dienen ihnen primär als Ausweis dafür, wie „exakt“ sie das Wahlergebnis bereits um 18 Uhr „vorhersagten“ – nett, aber, wie Justizministerin Zypries bereits anmerkte, nicht wirklich wichtig, wenn bereits zwei bis drei Stunden später ein vorläufiges Endergebnis vorliegt.
Welche Schlüsse sollte man also ziehen? Exit Polls verbieten? Ich würde sagen: Nicht das Kind mit dem Bade ausschütten! Wer über Zwischenergebnisse plappert, sollte ernste Konsequenzen zu fürchten haben. Aber auch der Nutzen der exit polls sollte gesteigert werden. Letzteres bedeutet, dass das Instrument mehr Analysemöglichkeiten eröffnen, d.h. die Befragungen umfangreicher werden sollten. Dies macht aber nur dann Sinn, wenn die Fernsehanstalten schon früh am Wahlabend Analysen auf dieser Datengrundlage anbieten und nicht die erste Stunde primär mit Interviews von Wahlparties, mit Politikern und ein paar Hochrechnungen füllen. Und schliesslich – sozusagen ein Hinweis in eigener Sache – müssten zumindest die Exit-Poll-Daten der öffentlich-rechtlichen Anstalten auch der Wissenschaft zur Analyse zur Verfügung gestellt werden. Zeitnah. Ohne Wenn und Aber.
Literaturhinweise:
Jürgen Hofrichter (1999): Exit Polls and Election Campaigns, in Newman (Hg.).: Handbook of Political Marketing.
Warren J. Mitofski (2000): Exit Polls, in: Rose (Hg.): International Encyclopedia of Elections.
Andreas M. Wüst (2002 u.a.): Exit Poll, in: Nohlen/Schultze (Hg.): Lexikon der Politikwissenschaft, Bd. 1.
 Wahltagsbefragungen (vulgo: Exit Polls) sind derzeit in aller Munde – vor allem wegen der vermeintlichen Gefahr von Manipulationen in Fällen, in denen die Ergebnisse solcher Befragungen frühzeitig veröffentlicht werden, zum Beispiel über „das Plauderforum“ (FAZ von heute) Twitter. Die Diskussion, darauf ist hier schon mehrfach hingewiesen worden, ist aus mehrerlei Gründen bemerkenswert: Einerseits weil es die Frage der Gleichheit aller Wahlberechtigten berührt (wer darf vorab die Ergebnisse wissen, wer nicht – und warum eigentlich?), andererseits weil wissenschaftliche Studien bislang keine stabilen, einseitigen Effekte von Umfrageveröffentlichungen auf Wahlentscheidungen nachweisen konnten. Viel Rauch um Nichts also?
Wahltagsbefragungen (vulgo: Exit Polls) sind derzeit in aller Munde – vor allem wegen der vermeintlichen Gefahr von Manipulationen in Fällen, in denen die Ergebnisse solcher Befragungen frühzeitig veröffentlicht werden, zum Beispiel über „das Plauderforum“ (FAZ von heute) Twitter. Die Diskussion, darauf ist hier schon mehrfach hingewiesen worden, ist aus mehrerlei Gründen bemerkenswert: Einerseits weil es die Frage der Gleichheit aller Wahlberechtigten berührt (wer darf vorab die Ergebnisse wissen, wer nicht – und warum eigentlich?), andererseits weil wissenschaftliche Studien bislang keine stabilen, einseitigen Effekte von Umfrageveröffentlichungen auf Wahlentscheidungen nachweisen konnten. Viel Rauch um Nichts also?